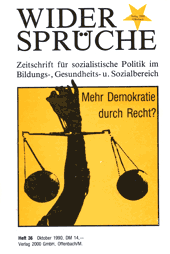Mehr Demokratie durch Recht?
Editorial
Daß Geld und Recht den Alltag strukturieren wie keine anderen "Steuerungsmedien", dürfte weithin unbestritten sein. Während aber dem Materiellen, dem Geld, dem Kapital als der "Basis" gesellschaftlicher Reproduktion immer große Aufmerksamkeit zuteil geworden ist, wurde das "Recht" stets als etwas Sekundäres, Abgeleitetes dem "Überbau" zugeschlagen.
Zunehmend aber wird deutlich, daß Ökonomie und Recht in einem gegenseitigen Konstitutionsverhältnis zueinander stehen, daß ökonomische Dimensionen stets auch von rechtlichen flankiert werden, bzw. diese zur Voraussetzung haben. Diese Sicht, Recht als sekundäre Überbauerscheinung zu fassen, war von einer Analyse des Verhältnisses von Staat und Ökonomie angeleitet, die davon ausging, daß der Staat aus den Anforderungen der Konkurrenz der Einzelkapitalien hervorginge und qua Macht "Recht" durchzusetzen in der Lage ist. Auch hier blieb der Staat formal nachgeordnet, blieb "Überbau". Dieser Schematismus des Vorrangs des Ökonomischen und der "Ableitung" des Staates als Sekundärem hat lange Zeit den Blick auf die konstitutive Funktion des Staates und mit ihm des Rechtes für die Reproduktion der Ökonomie und der Gesellschaft verstellt. Diese formale Nachordnung des Rechts im Hinblick auf die Ökonomie ist ein Grund dafür, daß die Bedeutung von "Recht" im Rahmen linker Theoriearbeit unterbewertet wurde. Ein weiteres Resultat der "Staatsableiterei" war eine Staatsvorstellung, die trotz der sekundären Verortung, den Staat als ein weithin widerspruchsfreies, monolithisches Subjekt gesehen hat, das linear die Anforderungen der Ökonomie in Recht transformiert, diese mittels der Staatsapparate umsetzt und mit Macht absichert. Der Staat als "Büttel des Kapitals", ausgestattet mit einem riesigen Überwachungs- und Repressionspotential, in dem der Justizapparat ein Kernstück darstellt - die Sache schien doch eindeutig und klar.
In der Auseinandersetzung mit Gramsci und Poulantzas kann diese eindimensionale Sicht des Staates relativiert und aufgehoben werden. Der Staat ist in deren Sicht primär ein Resultat sozialer Auseinandersetzungen, die Institutionen des Staates sind nicht einfach ableitbar, sondern sind die materialisierten Kompromisse der Politiken sozialer Akteure - traditionell gesprochen - oder das Resultat von "Klassenkämpfen". Es ist nicht zu unterschätzen, daß der Staat und seine Institutionen eine expansive Eigendynamik entwickelt haben. Diese wird angetrieben durch das "Interesse des Staates an sich selbst" (Offe), das er zu seiner Aufrechterhaltung und zur Erfüllung seiner Funktion als Vermittler sozialer Kämpfe notwendig haben muß. Trotz dieses Scheins seiner subjektiven Autonomie macht jedoch die Perspektive des Staates als "Terrain sozialer Auseinandersetzungen" (Poulantzas) eine Dimension im Verhältnis von Staat und Gesellschaft deutlich: Daß - mit Gramsci gesprochen - die Sichtweise des Staates als "società politicà", der Seite des bürgerlichen, integralen Staates, die den Zwang organisiert, den Blick verstellen kann auf die "società civile", die Seite, auf der der Konsens, die Hegemonie gebildet wird.
Gerade vor dem spezifisch deutschen Hintergrund, wo durch die Schwäche des deutschen Bürgertums sich nie eine bürgerlich zivile Gesellschaft von Gewicht herausbilden konnte, war der Blick auf den Staat - auch in der Analyse der Linken - stets auf die obrigkeitlich autoritäre-repressive Dimension der "società politicà" gerichet: Der Staat als monolithisches Subjekt. Das Verhältnis von "società civile" und "società politicà" ist aber der zentrale Indikator für den Grad der Vergesellschaftung oder der Verstaatlichung des öffentlichen und privaten Lebens in entwickelten kapitalistischen Gesellschaften. Je mehr in den obrigkeitsstaatlichen Staats"apparaten" reguliert wurde, desto weniger war öffentliche Auseinandersetzung über Form und Inhalt der Regulation des Lebens möglich. Wen die Frage nach Selbstbestimmung und Demokratie umtreibt, dem muß daran gelegen sein, die Regulation so weit wie möglich in die Gesellschaft, in die "società civile" zurückzuholen. Die società civile ist keinesfalls mit "bürgerlicher Gesellschaft" zu übersetzen, sondern - darauf hat W.F. Haug hingewiesen - muß begriffen werden "als die Dimension der Zivilität, der Bürgertugenden, des Bürgersinns, des Citoyens, überhaupt der zivilisierten Gesellschaft, der Zivilisation in einem Sinn, der auch Fragen der Lebensgestaltung, Gewohnheiten, Empfindungs-, Seh- und Ausdrucksweisen der Wirklichkeit usw. umfaßt."
In einer solchen "Zivilgesellschaft" muß der Kampf und die Auseinandersetzung um selbstbestimmte Lebensgestaltung und die gesellschaftliche Regulation öffentlichdemokratisch geführt werden, womit zugleich die bürgerlich-kapitalistische, bourgeoise Hegemonie in der "società civile" grundsätzlich infrage gestellt und bekämpft werden muß. Dabei stellt sich zugleich die Frage nach den Institutionen und Prozeduren, die an die Stelle der staatlichen Formen und Verarbeitungsweisen der Regulation treten sollen.
Wie kann der universalistische Charakter des Rechts in einer Gesellschaft aufrechterhalten werden, in der der Staat als autoritärer Garant nicht stets schon drohend im Hintergrund steht? Wie kann eine solche "Zurücknahme des Staates in die Gesellschaft" realisiert werden, in welchem Verhältnis stehen hier plebiszitäre und repräsentative Elemente demokratischer Gesellschaften? Wie kann vor dem Hintergrund einer, wie auch immer - jetzt undeutlich gewordenen sozialistischen Perspektive - die Aufhebung des bürgerlichen Rechts vonstatten gehen, ohne daß dessen positive, bürgerrechtlichen Elemente verschüttet und/oder unterlaufen werden? Dieses Heft ist eine erste Annäherung an diese Fragestellungen und bleibt daher notwendig fragmentarisch. Auch ist durch die Entwicklungen in der DDR das ganze Thema noch komplexer geworden. Unser Blick versucht daher beides im Auge zu haben: die Problematisierung sozialer und gesellschaftlicher Konflikte durch rechtliche Regelungen hier - und die Reflexionen über Recht und Verfassungsdiskussion in der DDR.
Reinhard Kreissl befaßt sich in seinem Beitrag mit Problemen der Verrechtlichung - vor allem im Bereich der Sozialpolitik. Das Recht, so Kreissl, ist zum einen der Flaschenhals, durch den staatliches Handeln hindurch müsse. Es besitze zum anderen aber auch eine Eigendynamik, die das verändere und verzerre, was von oben eingegeben wird bis es zum Output für die Gesellschaft kommt. Ein zentraler Auseinandersetzungspunkt in der Verrechtlichungsdebatte ist die Frage, ob der Rückgriff auf das Recht wirklich die adäquate Lösung für das jeweilige Problem ist. Gerade am Beispiel der Sozialpolitik zeige sich, daß hier gutgemeinte Regelungsabsichten oft problematische Wirkungen erzeugen. Dieses Dilemma macht auch die Grenzen rechtlicher Steuerungsfähigkeiten deutlich. Um gerade im sozialen Bereich einer "Kolonialisierung der Lebenswelten" (Habermas) entgegenzuwirken, schlagen Kritiker der Verrechtlichung vor, das Recht zu entformalisieren und zu flexibilisieren. Kreissl mißt den konkreten Umsetzbarkeiten der Deregulierung und Flexibilisierung von Recht allerdings nur geringe Chancen zu. Eine realistischere Perspektive sieht er eher in der Forderung nach einer Absicherung rechtlicher Beteiligung der von Regulationen direkt Betroffenen.
Volkmar Schöneburg widmet sich in seinem Artikel den Visionen, Forderungen und Erfahrungen des Strafrechtes und des Strafvollzugs in der 40-jährigen DDR-Geschichte. Er bemüht sich dabei um eine differenzierte Analyse des gewesenen - praktizierten wie theoretischen Strafrechts in der DDR. Gemeinhin herrscht in der Öffentlichkeit hier ja das Bild eines restriktiven politischen Strafrechts mit zum parteipolitischen Instrument degradierten Richtern und eines überfüllten, unter katastrophalen Bedingungen existiert habenden Strafvollzugs. Mit solch einem Bild würden natürlich die Finger auf die Wunden des "bürokratisch-sozialistischen Sozialismus" gelegt. Gleichzeitig, so Volkmar Schöneburg, werde damit aber auch der Blick auf die Gesamtsicht "unserer Geschichte des Strafrechts" verstellt, wie auch das strafrechtstheoretische Denken vernachlässigt. Schöneburgs Aufsatz ist ein erster Versuch, die Strafrechtsgeschichte der DDR mit ihren Widersprüchen, Fehlentwicklungen, aber auch mit ihren Erfahrungen und Errungenschaften aufzuarbeiten. Nicht alles sei dabei auf den Müllhaufen der Geschichte zu kippen. Schöneburg sieht zum Beispiel in der im DDR-Strafrecht angelegten Tendenz, soziale Konflikte durch die Gesellschaft und die Beteiligten zu lösen, anstatt sie dritten Instanzen (Staat) zu übertragen, einen Ansatzpunkt, um in einem vereinigten Deutschland auch neue Formen der Konfliktregelung anzugehen.
Karl-Heinz Schöneburg äußert sich in dem Interview, das Timm Kunstreich mit ihm am 20. Juni 1990 in Potsdam geführt hat, zu den "lebendigen Überresten", die von der Verfassungsdiskussion in der DDR bleiben. Zumindest bleiben, so meint der Verfassungsexperte Schöneburg im Gespräch, die Ideen und Diskussionen darüber, wie eine menschenwürdige Gesellschaft verfassungsrechtlich gestaltet werden muß, weiter lebendig. Den Geist des Runden Tisches gibt Schöneburg nicht verloren, schon deshalb nicht, weil sich, seiner Meinung nach, die Menschen in der DDR, wie auch in anderen osteuropäischen Ländern ihrer Kraft - die sich gegen ein autoritäres Regime erhoben und es besiegt habe - bewußt geworden sind. Selbst, wenn diese Kraft, wie jetzt, durch eine westliche Konsumorientierung überschattet wird, könne die Erinnerung an diese Kraft doch nicht einfach erlischen. Optimistisch glaubt Schöneburg, daß sich aus den gesellschaftlichen Widersprüchen von Kapitalismus und neuem demokratischem Bewußtsein, etwas gesellschaftlich Neues entwickeln werde, wie immer dieses "Neue" auch heißen mag, ob "zivile Gesellschaft oder anders..."
Soviel dürfte deutlich sein: Die Frage nach der Bedeutung des Rechts für eine bewußte, selbstbestimmte Lebensführung ist zentral in die Frage nach der rechtlichen Verfaßtheit der "Zivilgesellschaft" eingebunden.
Offenbach, im Oktober 1990