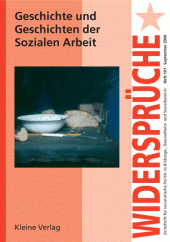
Geschichte und Geschichten der Sozialen Arbeit
Schwerpunkt
Im Editorial zu diesem Heft heißt es: Die Geschichte der Sozialen Arbeit ist Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts und die sie schreiben, sind ohne Ausnahme in diesem Jahrhundert geboren und herangewachsen [...]. Diese Generationen- und Epochenbezüge spiegeln sich in den Beiträgen und geben dem Heft seine besondere Prägung. Der Beziehung zwischen der Lebensgeschichte des Einzelnen in seiner Zeit und über diese Zeit zu den ihr vorangegangenen geschichtlichen Zeiten wird in diesem Beitrag, immer wieder angebunden an die Geschichte der Sozialen Arbeit, verallgemeinernd nachgegangen.
Die Geschichte des Alice-Salomon-Archivs fällt nicht mit der der Alice-Salomon-Schule und der ihrer Gründerin zusammen. Der Beitrag zeigt die historischen Einschnitte, Distanzen und kritischen Vorbehalte auf, die die Etablierung des Archivs bestimmt haben. Neue Lesarten der historischen Texte werden erläutert und es wird auf die Bedeutung hingewiesen, die diese für die Entwicklung einer beruflichen Identität der Sozialarbeiter/innen haben können.
Forum
Rezensionen
Editorial
"Das ist doch Geschichte" sagt jemand abwehrend, manchmal genervt, wenn ihr der Blick zurück untauglich für das Leben "im Hier und Jetzt" erscheint, wenn ihr "das Vergangene" den "Augenblick" verstellt, der wie sie meint, sie das Unmittelbare als einzige Wirklichkeit erfahren lässt. Dem halten Historiker und Geschichtsphilosophen in der Regel entgegen, dass es keine unvermittelte Gegenwart gebe, ja mehr noch, überhaupt kein unmittelbares Erleben des "Augenblicks", worin sich das prinzipielle Misstrauen des reflexiven Denkens gegenüber den "Trugbildern des spontanen Bewusstseins" (Paul Ricoeur) spiegele. Unsere Wahrnehmung der "Welt" in der Jetzt-Zeit sei bis hinein in das Riechen, Tasten, Hören, Sehen und alle Lüste und Schmerzen des Körpers eben auch durch das längst vergangene Leben zumindest berührt, wenn nicht gar mit-bestimmt. Leben in der Gegenwart ohne mit-leben der Vergangenheit sei nicht wirklich, es sei nicht einmal zu denken.
Jeder Augenblick im Jetzt habe ein Vor-Her und ein Her-Nach, meinte Adorno im Hinblick auf die Geschichtsvergessenheit der Mehrheit der Deutschen nach dem Ende der NS-Herrschaft bezogen auf das Vor-Her aber auch im Hinblick auf einen bestimmten Umgang mit der NS-Vergangenheit im Her-Nach. Auch dem Versuch der "Aufarbeitung der Geschichte" stand Adorno skeptisch gegenüber und formulierte Bedingungen für den Umgang mit dem "Erinnern". In diesem "Aufarbeiten" sah er - Ende der 50er Jahre - die Tendenz der "Normalisierung", die Absicht, die Vergangenheit zu "bewältigen", um "endlich einen normalen Umgang mit der Geschichte" zu erreichen mit dem Ziel, sich dieser Vergangenheit zu entledigen, zumindest aber sie zu neutralisieren beziehungsweise sie in kanonisierter Form in den Schulbüchern abzulegen und sie so der nachwachsenden Generation zu präsentieren. Mit dem Her-Nach erinnert uns Adorno an die im "Augenblick" - nicht zuletzt aus lebenspraktischen Gründen - vergessene Binsenwahrheit, dass unser Handeln im Jetzt schon bald - "über eine kurze Weile", wie es in der Bibel heißt - selbst Vergangenheit geworden ist und in dieser Gestalt hineinwirkt in das Leben von Morgen, das wir "Zukunft" nennen. "Zukunft" - die wir bei aller Gegenwartsfixierung doch ständig im Munde führen, um sie als Legitimation für fragwürdiges Handeln im Heute zu missbrauchen. Was Adorno mit Bezug auf den "Umgang" in Deutschland mit der NS-Geschichte sagte, gilt natürlich für die Geschichte überhaupt und überall auf der Welt: Man kann sie nicht "aufarbeiten", um sie in den Archiven und im Gedächtnis zu entsorgen.
Aber was dann wollen/sollen wir mit "unserer Geschichte" anfangen? Und wenn es stimmt, dass jede Befassung mit der Vergangenheit, mit dem Vergangenen, mit dem, was immer schon vorbei ist, nur Interpretationen von Fakten, von "Tat-Sachen" sein kann, die uns schon als solche nicht unmittelbar gegeben sind, die unserem retrospektiven Blick nicht einfach zugänglich sind, nicht nur, weil "der Zahn der Zeit an ihnen genagt" hat, sondern weil unser Blick die "historischen Requisiten" unweigerlich so formt, dass sie für die Konstruktionen der Gegenwart brauchbar, zumindest aber nicht störend sind? Geschichte als die Summe des Vergangenen und Geschichtsschreibung als dessen Wahrnehmung und Interpretation sind Verschiedene, die nie ganz zusammenkommen werden. Nicht allein die Differenz zwischen gesellschaftlicher Tiefenstruktur und erscheinender Oberfläche, auch die Debatten um Politiken der Erinnerung zeigen dies - gerade auch in ihren Bezügen auf die "Besetzung" von Geschichte, auf deren hegemonialen und gegenhegemonialen Charakter.
Annäherungen sind möglich und auch die sind divergent, ja strittig, fordern zu öffentlichem Streiten heraus und haben häufig eine kurze Halbwertzeit, wie uns die Geschichte der Geschichtsschreibung zeigt. "Zu welchem Ende", also, "studieren wir Universalgeschichte"? fragt Schiller in seiner Jenaer Antrittsvorlesung, eine Frage, die noch schwerer zu beantworten ist, seitdem wir eine Ahnung von der "Dialektik der Aufklärung" haben, die uns den pädagogischen Optimismus des auf die Synthese vertrauenden Kantianers Schiller gebrochen hat und die, fokussiert auf die Geschichte einer Profession, diesem "Pünktchen" im Universum der Geschichte, das wir so ernst nehmen, dass wir ihm ein ganzes Heft der "Widersprüche" widmen, noch viel kontingenter ist, weil wir uns mit ihr ja nicht losgelöst von dieser "Universalgeschichte" befassen können, vielmehr wir alten Versuchen, gerade das zu tun, widerstehen müssen.
Warum müssen? Steckt in dieser Behauptung nicht schon wieder ein heimlicher Lehrplan zum "richtigen Umgang", diesmal mit der Geschichte unseres Berufs? Kann es denn "den richtigen Umgang" damit, nach allem Gesagten überhaupt geben? Und ist denn die Frage, ob es überhaupt "Sinn macht", sich mit der Geschichte zu befassen, schon beantwortet?
Theodor Lessing, der Geschichtsphilosoph aus Hannover, den braune Studentenhorden schon vor "33" misshandelten und den die NS-Schergen 1933 im tschechischen Exil ermordeten, gab seinem Hauptwerk den Titel "Geschichtsschreibung als Sinngebung des Sinnlosen" und nannte die Geschichtswissenschaft eine "Logificatio postfestum". Mit dem "Schreiben der Geschichte", vermutete Theodor Lessing, versuchen wir, dem Chaos, das wir Geschichte nennen, im Nachhinein einen Sinn unterzuschieben, weil wir dessen Sinn-Losigkeit, deren Erkenntnis uns an der Zukunft verzweifeln lassen könnte, nicht ertragen können und wollen. Das berühmte "Aus der Geschichte lernen" also nichts als eine beruhigende Selbsttäuschung? Lessing kam zu dieser Auffassung nach der schrecklichen Erfahrung mit dem Ersten Weltkrieg, gegen den er 1914 als einer der ganz wenigen öffentlich als pazifistischer Redner aufgetreten war, womit er Schmähungen, Verachtung, physische Bedrohung und zuletzt Vereinsamung erntete. Mit seinem leidenschaftlichen Hinweis auf die fürchterlichen Folgen der sich aneinander reihenden Kriege in der "Weltgeschichte" scheiterte er am patriotischen Taumel der Kriegsbegeisterung (vieler), diesem empirischen Beleg für die Unfähigkeit, aus der Geschichte zu lernen - oder ist es nur ein Beleg für ein unter bestimmten Umständen (die vielleicht geändert werden könnten oder sich verändern) nicht-lernen-wollen? Zeitgleich schrieb Siegmund Freud seinen pessimistischen Essay "Über das Unbehagen in der Kultur" und versuchte die die Menschheitsgeschichte durchziehende Todesfurche des Krieges, "Das rote Band von Blut und Tränen", resigniert mit einem gattungsspezifischen Trieb zum Tode (Thanatos) zu erklären.
Aber Theodor Lessing und letztlich auch Sigmund Freud gaben dem Leben in Gegenwart und Zukunft trotz ihrer pessimistischen Sicht auf das "Lernen aus der Geschichte", trotz ihres Abschieds vom linearen Fortschrittsdenken der philosophischen Aufklärung, eine Chance, die auch in der von der Erfahrung des Nationalsozialismus bestimmten Gesellschafts- und Kulturkritik Horkheimers und Adornos nicht verloren geht und die Leszek Kolakowski in den siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts mit dem Satz auf den Punkt brachte: "Leben trotz Geschichte!" Dieses "Dennoch" hat Camus in seinem "Mythos von Sisyphos" existenzphilosophisch zu Ende gedacht.
Wir, das heißt die Redaktion der "Widersprüche" mit unseren divergierenden Geschichtsauffassungen und analytischen Schwerpunktsetzungen (um es an Namen festzumachen: diversen Legierungen des Marxismus - von Luxemburg bis Adorno -, Bezugnahmen auf Foucault) waren uns in zwei Punkten einig, als wir uns zum Thema dieses Heftes entschlossen:
1. Da die Geschichtsschreibung über die Soziale Arbeit immer ein Teil der Selbstdarstellung der Profession war und ist und überwiegend von AkteurInnen des Berufsfeldes betrieben wird - also eine sehr häufig Selbst-Geschichtsschreibung ist - lohnt es sich, darüber nachzudenken, welche Funktionen diese Geschichtsschreibung hat, welche Absichten mit ihr verfolgt, welche Ziele mit ihr angestrebt werden.
2. Geschichtsschreibung ist eine unseres Erachtens unverzichtbare, wesentliche Ebene der Selbst-Reflexion der Sozialen Arbeit und zur Selbst-Aufklärung über das Handeln und Wirken in allen drei Dimensionen der geschichtlichen Zeit notwendig.
Aufklärung beginnt mit dem Zweifel, mit der Reflexion dessen, was im Alltagsbewusstsein allzu oft unhinterfragt als selbstverständlich gilt, zum Beispiel des Mythos von der Sozialen Arbeit als "helfendem Beruf" und die Verwendung der Basiskategorie "Hilfe" (neuerdings "Dienst-Leistung") zur Legitimation aller denkbaren "Maßnahmen" der Prävention und Intervention. Dass die Menschen (die Menschheit?) im Großen und Ganzen, in den dominanten Linien, aus der Geschichte wenig bis nichts gelernt haben, muss ja nicht bedeuten, dass solches Lernen prinzipiell nicht möglich ist. So wie Einzelne und manchmal Gruppen andere Schlüsse aus den historischen Ereignissen ziehen konnten und ziehen als die den "Zeitgeist" repräsentierende Mehrheit, können vielleicht auch größere Einheiten, zum Beispiel eine Profession wie die Soziale Arbeit, beziehungsweise die Mehrheit der ihr angehörenden Individuen, den Weg der "Herrschaft des Menschen über den Menschen" verlassen. Geschichtsschreibung als Selbst-Aufklärung eröffnet unseres Erachtens zumindest die Chance, das aus "Gewohnheit" und anderen Gründen Übernommene kritisch zu prüfen und die "naiven" Identifikationen und Sichtweisen, in deren moralischen Gestus die hegemonialen Funktionen Sozialer Arbeit noch immer verborgen sind, vielleicht zu verhindern. "Leben trotz Geschichte" ist ja nicht nur ein trotziges Dennoch. Es könnte nicht gehalten werden, wenn die Zuversicht, dass solches Leben möglich ist, nicht mit enthalten wäre. Das ist freilich nicht mehr, aber auch nicht weniger als eine Hoffnung, die dem "Staunen" - das eigentlich ein Erschrecken ist - "darüber, dass die Dinge, die wir erleben, im zwanzigsten Jahrhundert ‚noch' möglich sind", immer wieder abgerungen werden muss. Dieses "Staunen", schreibt Walter Benjamin in seinen "Thesen über den Begriff der Geschichte", sei "kein philosophisches. Es steht nicht am Anfang einer Erkenntnis, es sei denn der, dass die Vorstellung von Geschichte, aus der es stammt, nicht zu halten ist". Nur ein von jeder historischen Erfahrung unbeirrter Optimismus könnte nach "unserem zwanzigsten Jahrhundert" Benjamins Einsicht bestreiten wollen. Das "Dennoch" (oder: "Trotz alledem"), dem dieses Heft der "Widersprüche" sein Thema verdankt, entsteht nicht aus dem Widerspruch zu Benjamins These, sondern aus ihrer Anerkennung. Es wäre ohne die Erkenntnis, dass das "Staunen über das Noch" aus einer nach dem zwanzigsten Jahrhundert nicht mehr zu haltenden Vorstellung von Geschichte (als ungebrochener Fortschrittsgeschichte) stammt, für uns nicht möglich. Das "Dennoch" hat viele Namen. Sie reichen vom Eros/Lebenstrieb Freuds über Albert Schweitzers "Habt Ehrfurcht vor dem Leben" zu Blochs "Prinzip Hoffnung", Horkheimers/Adornos dialektischer Verschlingung von Herrschaft und Emanzipation bis hin zum Sozialpädagogischen Eros, sofern er seine Verankerung in der unteilbaren Würde des Menschen - des Einzelnen und nicht "der Menschheit" - und in den politischen und sozialen Menschenrechten sucht. Soviel zur Entscheidung der Redaktion zu diesem Heft.
Die Autorinnen und Autoren der Beiträge sind unserer Begründung nicht verpflichtet. Wir haben sie eingeladen als Akteure des divergenten Umgangs mit der Geschichte der Sozialen Arbeit, die unser gemeinsamer Gegenstand ist. Dass dieser Beruf im letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts im Kontext allen das zwanzigste Jahrhundert vorbereitenden politischen, ökonomischen und kulturellen Geschehens seinen Anfang hat (sieht man einmal von dem Vor-Her auch dieses Anfangs ab - christliche Liebestätigkeit, Humanismus, Arbeiterbewegung, Frauenbewegung etc.) und in allen seinen Bewegungen und Formen Teil der Geschichte dieses zwanzigsten Jahrhunderts ist, an dem "das Licht der Aufklärung" viel von seinem Glanz einbüßte, bestimmt unweigerlich nicht nur die Professionsgeschichte in ihrem faktischen Verlauf, sondern vor allem auch ihre Darstellung und Interpretation durch die Eigen-Geschichtsschreibung. Wie kaum ein anderes Handlungsfeld gesellschaftlicher Arbeit ist die Soziale Arbeit als Profession und Disziplin in Entstehung, Entfaltung und Verlauf identisch mit dem noch zur Zeitgeschichte gehörenden zwanzigsten Jahrhundert, wenn man als ihren Rahmen das Neben - und Ineinander von Großeltern/Eltern (auch als Kinder) und Kinder (auch als Enkel) nimmt, also den biologischen Generationenbegriff der Re-Generation in der Geschlechterfolge, zu der alle in diesem Heft Schreibenden gehören. Die Geschichte der Sozialen Arbeit ist Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts, und die sie schreiben, sind ohne Ausnahme in diesem Jahrhundert geboren und herangewachsen. Dennoch ist die Altersspanne der AutorInnen beträchtlich. Die Geburtsjahre reichen von 1928 bis 1970 und die Berufseintrittsjahre von 1956 bis 2006. Diese Generationen- und Epochenbezüge spiegeln sich in den Beiträgen und geben dem Heft seine besondere Prägung. Falls im Jahre 2056 die "Widersprüche" in der dann dreihundertsten Ausgabe wieder ein Heft zur Geschichtsschreibung in der Sozialen Arbeit herausbringen würden, hätten sich die das Heft 101 charakterisierenden Generationen- und Epochenbezüge aufgelöst. Sie wären dann nicht mehr "Zeitgeschichte", sondern "Geschichte" und die Soziale Arbeit selbst würde über eine Geschichte verfügen, deren Bedeutung für ihre Zeitgeschichte im einundzwanzigsten Jahrhundert untersucht werden müsste. Für ein solches Unterfangen wäre dieses Heft dann ein wichtiger historischer Quellentext. Der in dieser Perspektive steckenden Versuchung, mit unserem Schreiben heute den AkteurInnen der Sozialen Arbeit von über-morgen, unseren beruflichen Enkeln beziehungsweise Urenkeln "Botschaften" zu hinterlassen, widerstehen wir in dem Bewusstsein, dass die mit Geschichtsschreibung möglicherweise erzielte Selbst-Aufklärung dem Denken und Handeln in der Gegenwart und der unmittelbaren Zukunft nützen soll.
Die Redaktion
