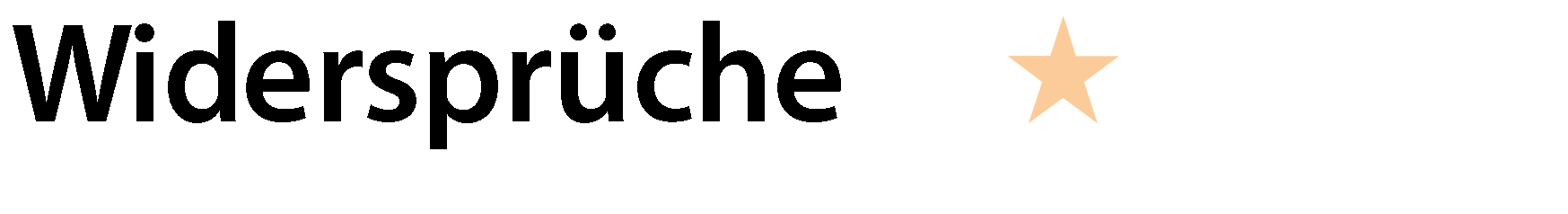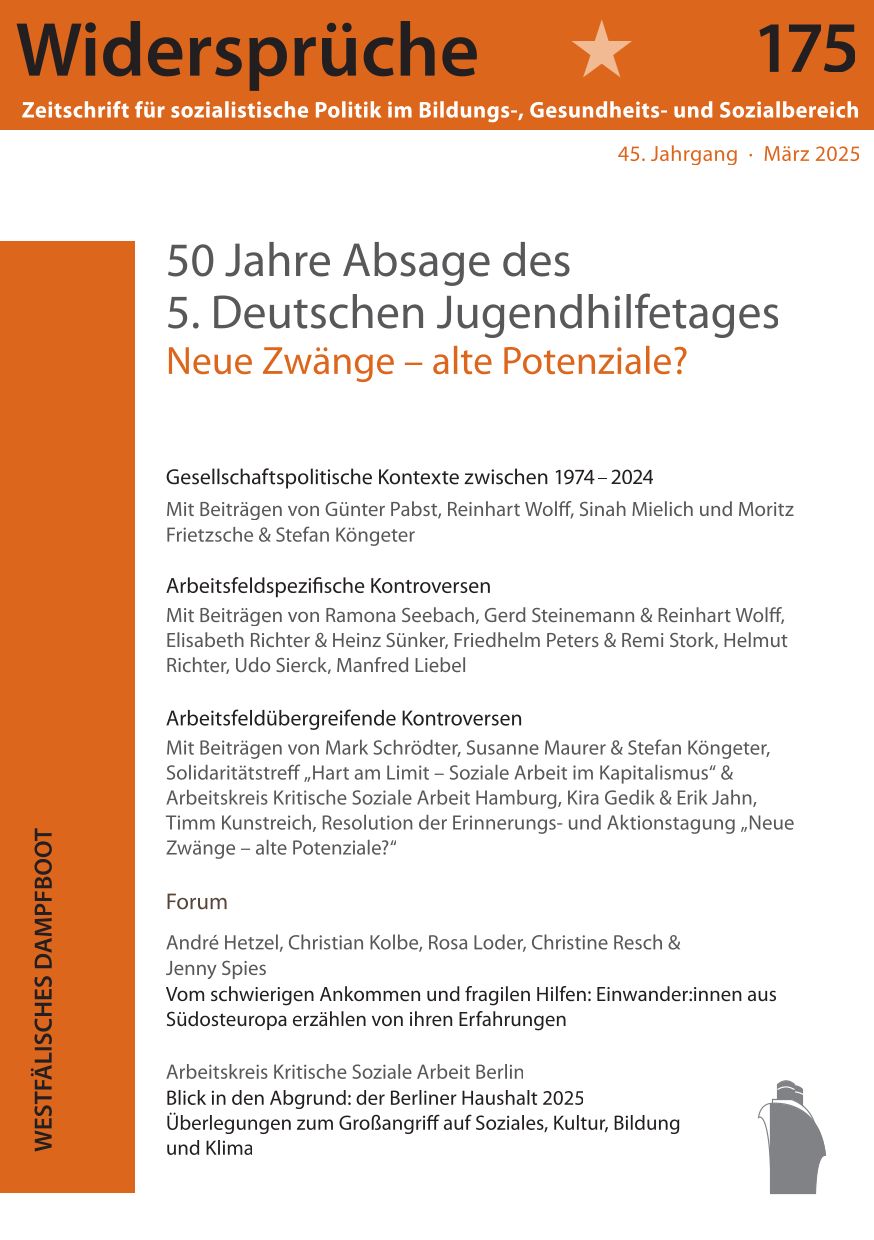50 Jahre Absage des 5. Deutschen Jugendhilfetages
Editorial
I
„Die Sozialistische Aktion hält unseren Staat nur insoweit für reformfähig und -willig, wie es den Interessen der ‚herrschenden Kräfte‘ im Staat nützt. Deshalb seien Reformen im Interesse der Kinder und Jugendlichen illusionär und unmöglich.“ (Brief der Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe (AGJ) vom 31. Mai 1974 zur Begründung der Absage des 5. Deutschen Jugendhilfetages in Hamburg)
Die Aussage im ersten Satz stimmt. Hingegen ist das Gegenteil der Schlussfolgerung im zweiten Satz richtig: Ziel der Sozialistischen Aktion war es, politische Strategien zu entwerfen, die trotz der Hegemonie der „herrschenden Kräfte“ den Interessen der Kinder und Jugendlichen dienen können.
Die Aufbruchszeit der „68er“, symbolisiert in der Heimrevolte 1969, bewegte auch die Sozialarbeiter:innen. Die staatstragenden und autoritären Strukturen in Schule, Kindergarten, Jugendzentren, aber auch in den Psychiatrien und in den Knästen sollten aufgebrochen werden – dabei wurde auch besonders die eigene Involviertheit in die Herrschaft sichernde Hegemonie zum Gegenstand der Kritik gemacht.
Auf dem 4. Deutschen Jugendhilfetag (DJHT) 1970 in Nürnberg präsentierte sich diese Sozialarbeiter:innenopposition als Sozialistische Aktion Jugendhilfetag zum ersten Mal. Es ging ihr darum, die repressive und individualisierende Sozialarbeit vom idealistischen bürgerlichen Kopf auf materialistische Füße zu stellen. Das sollte im Zentrum des 5. DJHT 1974 in Hamburg stehen. Die Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe (AGJ) sagte diesen jedoch ab – als Antwort auf die Aktivitäten der Sozialistischen Aktion. Diese sah sich in dieser Absage wiederum in ihrer Einschätzung bestärkt, „daß der Jugendhilfetag lediglich der schein-demokratischen Legitimation der Jugendpolitik der regierungs- und verbandsbürokratischen Kräfte dienen und die Loyalität der Fachbasis gegenüber dem bürgerlichen Staat sicherstellen sollte“ (Presseerklärung Sozialistische Aktion Jugendhilfetag Hamburg, 25.5.1974).
In einer weiteren Presserklärung vom 17.6.1974 formuliert die Sozialistische Aktion:
"Die AGJ benutzt ferner die Absage, um kritische Sozialarbeiter zu disziplinieren und zu diffamieren, indem sie behauptet, die in der Sozialistischen Aktion repräsentierten Sozialarbeitergruppen wollten die freiheitlich-demokratische Ordnung unseres Staates‘ und die betreuten Kinder und Jugendlichen in Wahrheit doch nur für die Durchsetzung ihrer politischen Ziele missbrauchen."
Bei den Gruppen, die sich zum bundesweiten Sozialistischen Aktionsbündnis zusammengeschlossen hatten, traf die Absage auf einhellige Empörung. Diese führte nicht zuletzt dazu, im Dezember des gleichen Jahres in Frankfurt ein „Jugendpolitisches Forum“ (JuPoFo) mit über 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durchzuführen, darunter ca. 400 Jugendliche.
Der unmissverständliche Hinweis der AGJ auf die angeblich mangelnde Verfassungstreue der oppositionellen Fachkräfte wurde widersprüchlich aufgenommen: Die einen hielten das für eine infame Unterstellung, die anderen sahen daran die Anerkennung ihrer „revolutionären Gefährlichkeit“. Für alle war jedoch selbstverständlich, den Kampf gegen die Berufsverbote zu intensivieren. Nicht zuletzt spielte dieses Thema auch immer eine wichtige Rolle in den sich gründenden Arbeitskreisen Kritischer Sozialarbeit.
50 Jahre später: Der AKS Hamburg beschließt, das Jubiläum der Absage des 5. Deutschen Jugendhilfetags zum Anlass zu nehmen, eine Erinnerungs- und Aktionstagung durchzuführen, um über Kontinuitäten, Konsequenzen, Kontroversen und Schlussfolgerungen für heute ins Gespräch zu kommen. In Auseinandersetzung mit der Geschichte der eigenen Assoziation, der Geschichte des AKS, als gemeinsame Unternehmung gesellschaftsverändernder Faktor zu sein[1], stießen die Autor:innen auf den Konflikt um die Absage des Hamburger Jugendhilfetages. Daraus entstanden unter anderem folgende Fragen zu den Konsequenzen dieser Absage: „Welche Fortschritte konnten erreicht werden? Welche Entwicklungen waren problematisch? Welche verschütteten Erfahrungen sollten heute aktualisiert werden?“ (AKS Hamburg 2024) Nachdem auch wichtige Zeitzeugen ihre Unterstützung und Teilnahme zugesagt hatten, formierte sich eine überregionale Vorbereitungsgruppe, deren Kern die verantwortlichen Veranstalter:innen bildeten: der AKS Hamburg, die Arbeitsbereiche Sozialpädagogik sowie Pädagogik bei Behinderung und Benachteiligung der Fakultät Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg sowie der Verband Kinder- und Jugendarbeit Hamburg e.V.. Die Veranstaltung fand mit über 100 Teilnehmenden am 20. und 21. September 2024 in der Universität Hamburg statt – unter dem Motto „Neue Zwänge – alte Potenziale?“. In diesem Heft soll auf der Tagung Referiertes, Gedachtes und Diskutiertes festgehalten und weiterentwickelt werden – als Impuls dafür, herrschafts-oppositionelles Wirken in der Sozialen Arbeit zu stärken.
Der AKS Hamburg hat zur Vorbereitung der Tagung mehrfach das Hamburger Institut für Sozialforschung besucht, um das vorhandene einschlägige Material zu sichten und für das Vorhaben aufzuarbeiten. Im Leseraum des Instituts warteten Boxen mit verschiedensten Materialien zu den Jugendhilfetagen im Zeitraum von 1970 bis 1974 auf uns. Davon beinhalteten vier Kästen die Protokolle diverser Vorbereitungstreffen sowie Stellungnahmen und fachliche Positionierungen der unterschiedlichen Gruppierungen rund um den 5. DJHT. Wir sichteten das Material nach Arbeitsfeld und Stellungnahmen und fanden zusätzlich viele interessante Zeitungsausschnitte und Karikaturen.
Aus der Recherchearbeit entstand die Idee, für die Fachtagung eine Ausstellung zu den historischen Bezügen zu erstellen, was wir auch umsetzten. (Bei Interesse an der Ausstellung freuen wir uns über eine Nachricht an aks-hamburg@gmx.de.)
Eine kleine Auswahl der Fundstücke und Motive schmückt dieses Heft. Einige andere Bilder stammen aus der Dokumentation des Jugendpolitischen Forums „Jugend in der Klassengesellschaft. Möglichkeiten fortschrittlicher Praxis“ von 1975.
Fest steht, dass wir uns ohne das umfangreiche vom Institut für Sozialforschung gesammelte Material nicht so umfänglich und vertieft mit den Konfliktlinien und Spannungen von damals hätten auseinandersetzen können. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken!
II
Wenn von Tagungen zu einer komplexen Thematik berichtet wird, gehört es in der Regel zum guten Ton, dass betont wird, dass die angesprochenen Themen so „vielfältig und divers“ gewesen seien, dass eine Gemeinsamkeit oder auch nur ein roter Faden nicht zu erkennen gewesen sei. Bei dieser Veranstaltung war das anders. Bei den natürlich auch hier zu findenden vielfältigen und zum Teil kontroversen Positionen gibt es einen gemeinsamen Ausgangs- und Bezugspunkt:
Alle Akteur:innen in der Sozialen Arbeit sind Subjekte und greifen verändernd in Gesellschaft ein, auch – und das widerspricht immer noch weitgehend der herrschenden Praxis – die Adressat:innen.
Sowohl in den Einleitungsvorträgen und der Podiumsdiskussion, als auch in den arbeitsfeldspezifischen Workshops und den thematisch übergreifenden Diskussionsforen[2] war diese Position zentrales Thema – manchmal implizit, meistens explizit. Die Spannbreite reicht dabei vom methodischen Individualismus bis hin zu Klasse als Subjekt. Mal wird die „wertschätzende Anerkennung“ des Gegenübers in der Nachfolge von Rogers betont, mal werden Gruppierungen von Kindern und Jugendlichen als eigenständige Subjekte hervorgehoben, mal sind es spezifische Milieus oder Klassenströmungen, die als die neuen Subjekte in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung gesehen werden, mal ist es die Hoffnung auf das Subjekt „Arbeiterklasse“, das alle Widersprüche aufheben würde. Diese Thematik – dass sowohl Fachkräfte als auch Adressat:innen Subjekte sind – zum ersten Mal in aller Schärfe und Deutlichkeit in den Vordergrund gestellt zu haben, ist ganz sicher das Verdienst der „Sozialistischen Aktion“, die sich 1970 auf dem 4. Jugendhilfetag in Nürnberg zu Wort meldete und die genau diese Debatte in den Mittelpunkt des 5. Jugendhilfetags in Hamburg stellen wollte (siehe den Beitrag von Reinhart Wolff).
Nicht mehr in dieser Bandbreite und politischen Kontroverse, aber als durchgehende fachlich-politisch-kulturelle Herausforderung blieb die – bedingungslose – Anerkennung von Kindern und Jugendlichen als Subjekte das zentrale Thema – und ist es jetzt noch. Zwar bestreitet heute niemand mehr, dass die „Unantastbarkeit der Würde des Menschen“ auch für Kinder und Jugendliche gilt, aber Kindern und Jugendlichen eigenständige Rechte zuzugestehen, das verhindert die Hegemonie derjenigen gesellschaftlichen Strömungen, die das Primat der Familie in der Zuständigkeit für die Erziehung hartnäckig verteidigen.
Seit dem abgesagten 5. DJHT 1974 wurden viele emanzipatorische Errungenschaften und Entwicklungen erkämpft, die mehr Beteiligung und Schutz junger Menschen erwirken konnten und auch rechtlich verankert wurden, wie zum Beispiel in der UN-Kinderrechtskonvention und in Ansätzen auch im KJHG, jetzt KJSG. Auch anderen unterdrückten Gruppen im patriarchal-kapitalistischen System gelang es, Gleichstellungs-, Beteiligungs- und Schutzrechte zu erkämpfen, vor allem Frauen, queere Personen, People of Color und behinderte Menschen (siehe den Beitrag von Udo Sierck). Diese Entwicklungen haben sie immer mit Fachkräften, Aktivist:innen und anderen Betroffenen gemeinsam erstritten. Eine gesellschaftliche, materielle Verwirklichung dieser Rechte steht allerdings größtenteils bis heute aus und schon Erreichtes wird wieder zunehmend in Frage gestellt.
Der aktuelle gesellschaftliche Rahmen ist vor allem geprägt durch Kriege, Krisen, Militarisierung und neoliberale Spar- und Verteilungskämpfe. Enorme Gewinnsteigerungen und extremer Reichtum bei einigen Wenigen bei gleichzeitigem Anstieg von Armut, kennzeichnen weiterhin die gesellschaftliche Entwicklung. Die jahrzehntelange neoliberale Politik auf Kosten des Sozialen treibt die gesellschaftliche Spaltung und die Stigmatisierung verschiedener Personengruppen immer zugespitzter und gezielt voran. Dies ist Nährboden für rechtspopulistische und faschistische Ideologien, Ziele und Narrative, die zunehmend Druck auf die gesellschaftlichen und politischen Debatten ausüben. Nazis werden wieder in Parlamente gewählt und die etablierten Parteien und Fraktionen lassen sich von rechts treiben.
Kinder- und Jugendhilfe ist ein spezifisch umkämpftes Feld in diesen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen: So gibt es gezielte Angriffe von rechten Kräften wie der AfD insbesondere auf Einrichtungen und Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendverbände. Sie gelten vor allem Einrichtungen, die emanzipatorisch ausgerichtet sind und für die Verwirklichung von Rechten eintreten. Autoritäre, disziplinierende Ansätze erfahren entsprechend mehr Unterstützung.
Die Interessen und Bedürfnisse junger Menschen kommen in den aktuellen Debatten kaum vor – sie werden vielmehr instrumentalisiert als zukünftiges gesellschaftliches „Kapital“. Junge Menschen sollen vor allem funktionieren und so keine Störung für ein „Weiter-so“ (auch im Sinne der proklamierten „Zeitenwende“) sein. Dafür werden sie vielfach als zu normalisierende und zu disziplinierende Objekte behandelt, die bei Verweigerung herrschender Erwartungen dressiert, kriminalisiert, pathologisiert, psychologisiert und in ihren Problemlagen individualisiert werden.
Auch innerhalb des Arbeitsfeldes gibt es Forderungen nach Anpassung an das Hilfesystem statt der Orientierung entlang der Interessen und Bedürfnissen junger Menschen. Adressat:innen werden in vermeintlich „gute“ und „schlechte“ Fälle gespalten und gegeneinander ausgespielt.
Die Sozialistische Aktion kritisierte in ihrem Aufruf zur Teilnahme am 5. DJHT die Verstärkung der Klassenunterdrückung durch die Verbände und Träger der Jugendhilfe – sowohl durch die fehlende Parteilichkeit für junge Menschen als auch durch aktive Deklassierung des Arbeitsfeldes. Die 1974 kritisierte Klassengesellschaft ist weiterhin existent, wenn auch in anderer Ausformung und in andere Begrifflichkeiten verpackt. Die früheren „Schmuddelkinder“, „Verwahrlosten“, „Halbstarken“, „Trebegänger“ und späteren „Crashkids“ heißen heute „Systemsprenger:innen“, „Intensivtäter:innen“ oder „Klaukinder“.
Auch hinsichtlich der Arbeitsbedingungen von Fachkräften lassen sich Parallelen zur Problembeschreibung von 1974 ziehen: Sie sind vielfach schlecht, unbezahlte Mehrarbeit ist weiterhin auf der Tagesordnung, eine klare pro-demokratische Parteinahme wird angegriffen – kaschiert unter Label wie Selbstoptimierung, Work-Life-Balance und einem vermeintlichen Neutralitätsgebot. Erkämpfte Arbeitnehmer:innenrechte finden zu wenig Eingang in die reale Berufspraxis, treffen auf fehlende Ressourcen und unzureichende Finanzierung. Ein internalisierter neoliberaler Individualismus und unternehmerisches Denken der Fachkräfte selbst stehen einer kollektiven Interessenvertretung in Gewerkschaft und Betrieb oft entgegen. Niedrige Tarifentgelte und -abschlüsse verdeutlichen, dass es uns bisher nicht gelungen ist, das Kräfteverhältnis zu Gunsten einer umfassenden sozialen Infrastruktur zu verändern.
Die aktuell geführten Debatten und Kontroversen in der Kinder- und Jugendhilfe finden in diesen skizzierten Widersprüchen und Spannungsfeldern statt. Auch sich emanzipatorisch verstehende Entwicklungen und Debatten sind nicht widerspruchsfrei. Diese Widersprüchlichkeiten und Kontroversen müssen in ihrer historischen Entwicklung begriffen, aufgedeckt und diskutiert werden – mit dem Ziel, das gemeinsame Dritte intergenerational zu entwickeln, um mehr ermächtigende Handlungsfähigkeit und gute Lebens- und Entwicklungsbedingungen für alle Menschen erreichen zu können.
Die vielen Facetten dieser Auseinandersetzungen bündeln sich wie in einem Brennglas in der Frage der „Geschlossenen Unterbringung“ (GU) bzw. der „freiheitsentziehenden Maßnahmen“. In diesen Ausschließungen werden nicht nur Kinder und Jugendliche diszipliniert und unterdrückt, sondern ebenso die Fachkräfte, die auf instrumentell reagierende und funktionierende „Reaktions-Deppen“ reduziert werden. Solange diese institutionelle Gewalt nicht beendet wird, wird es keine wirkliche Subjekthaftigkeit in der Kinder- und Jugendhilfe geben,
Die Frage, ob in die „elterliche Sorge“ überhaupt eingegriffen werden dürfe und ob außerhalb des Strafrechtes Freiheitsentzug erlaubt sein soll und wie dieser eventuell gestaltet werden müsste, bekam erst durch die Heimrevolte Ende der 1960er Jahre politisches Gewicht und spielte insbesondere 1978 auf dem 6. DJHT in Köln eine wichtige Rolle. Themen der Kinder- und Jugendarbeit hatten inzwischen insgesamt an Bedeutung gewonnen. Besonders die Jugendzentrumsbewegung, aber auch der zwar langsame, aber ständige Ausbau der Kindertagesbetreuung und nicht zuletzt der noch immer heftige Streit um die Heimerziehung insgesamt hatten eine derartige Resonanz erzeugt, dass zu diesem Jugendhilfetag ca. 20.000 Fachkräfte zusammenkamen und eine lebhafte Debatte zu diesen Themen führten. Die Gruppierungen der „Sozialistischen Aktion“ waren inzwischen entweder selbst in tonangebenden Positionen in der Jugendhilfeadministration angekommen („Marsch durch die Institutionen“) oder hatten – wie die AKS – das Angebot der Kooperation angenommen und arbeiteten tatkräftig mit (siehe auch den Beitrag von Günter Pabst).
Welche Tendenzen sich in der heftig und kontrovers geführten Auseinandersetzung um Freiheitsentziehende Maßnahmen/GU schließlich durchsetzten – und damit welche Konzeption von Subjektrechten sowohl von Kindern und Jugendlichen als auch Fachkräften –, lässt sich exemplarisch für das gesamte Feld der Kinder- und Jugendarbeit an den Jugendberichten bzw. Kinder- und Jugendberichten (KJB) nachvollziehen, die in jeder Legislaturperiode veröffentlicht werden. Sie dokumentieren die jeweiligen neuen Facetten in der Bildung eines hegemonialen Konsenses in dem Feld der Kinder-, Jugend- und Familienpolitik. In seiner Stellungnahme zum 14. Kinder- und Jugendbericht arbeitet die in dieser Diskussion tonangebende Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen (IGfH) folgende Tendenz heraus:
„Hatten sich der 8. und 9. KJB (1990 und 1994) noch begründet dezidiert gegen alle Formen ‚geschlossener Unterbringung‘ ausgesprochen, bricht der 11. KJB mit dieser Tradition: ‚Obwohl GU nach wie vor rechtlich umstritten ist [… und] trotz der in einer Reihe von Studien empirisch gut belegten negative Folgen geschlossener Unterbringung […], der dadurch erzeugten pädagogischen Widersprüche und der problematischen Sogeffekte geschlossener Einrichtungen‘ (Bundestag 2002: 240) – formulierte der 11. KJB, dass […] in wenigen, sehr seltenen Konstellationen die zeitweilige pädagogische Betreuung in einer geschlossenen Gruppe eine dem jeweiligen Fall angemessene Intervention sein (kann)‘ (Deutscher Bundestag 2002: 240). Der aktuelle 14. KJB wiederholt diese Formulierung nahezu wortgleich (vgl.: 500). Dennoch verschiebt sich die Position nicht nur im Detail“ (IGfH 2013: 8)
Vielmehr wird jetzt festgestellt, dass die GU nicht mehr „nur eine angemessene Reaktion sein kann, sondern fachlich geboten erscheint – und nicht nur für Jugendliche, sondern auch für beschädigte Kinder“ (IGfH 2013: 10). Diese „fachliche Akzeptanz im Einzelfall“ setzte sich durch und ist bis heute dominant.
Im aktuellen 17. Kinder- und Jugendbericht (2024) wird der Konflikt um geschlossene Unterbringung zwar angesprochen, aber aus der Kritik werden keine Konsequenzen gezogen – eine eindeutige Positionierung fehlt auch hier.
Die „Zeitenwende“ vom 14. Kinder- und Jugendbericht (2002) wird auf diese Weise offensichtlich bestätigt. Welche Rückwirkung diese angeblich fein dosierte „Vergabe“ von Einschließung im „Einzelfall“ auf das gesamte Feld der stationären Unterbringung hat, bleibt damit tabuisiert, auch wenn die „Dressur“ (Degener u.a. 2020) die Praxis dieses Feldes zu dominieren droht. Die Verwirklichung eigenständiger Subjektrechte von Kindern und Jugendlichen bleibt daher eine zentrale Forderung auf dem Weg in eine umfassend demokratische Gesellschaft. Das wird nur gelingen, wenn es die Fachkräfte schaffen, diesen Prozess aus eigenen Interessen zu unterstützen und zu befördern. „Wir können uns unsere Motive nicht bei den Klienten ausleihen, wir müssen unsere eigenen entwickeln und umsetzen“ – so sinngemäß Franco und Franca Basaglia in dem Reader „Befriedungsverbrechen“ (1980).
Es würde zu weit führen, all die Anknüpfungspunkte aufzuführen, die sich zu Beiträgen in der über 40-jährigen Geschichte unserer Zeitschrift ergeben. Stattdessen möchten wir exemplarisch auf die vielen Beiträge verweisen, mit denen Manfred Kappeler zu den zentralen Themen der Kinder- und Jugendpolitik nicht nur Stellung genommen hat, sondern diese auch selbst gesetzt bzw. mitgestaltet hat. Auf der Homepage unserer Zeitschrift (www.widersprueche-zeitschrift.de) sind in der Autor:innen-Rubrik seine Textbeiträge zu finden und in diesen (bzw. in den entsprechenden Literaturhinweisen) finden sich weitere Belege seines Wirkens. Als Einstieg und kostenloser Download eignet sich sein materialreicher Beitrag: „Heimerziehung in der (alten) Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik - und was wir daraus lernen können. Eine Textcollage“ in Heft 129: 17-33.
Die Redaktion
Literatur
Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit Hamburg 2024: „5. Deutscher Jugendhilfetag – revisited“ am 20./21.09.24 – Programmflyer. Online unter: letzter Zugriff: 02.01.25
Basaglia, F./Basaglia-Ongaro, F. (Hg.) 1980: Befriedungsverbrechen. Über die Dienstbarkeit der intellektuellen. Frankfurt/M.
Brief der Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe vom 31. Mai 1974 zur Begründung der Absage des 5. Deutschen Jugendhilfetages in Hamburg
Degener, Lea/Kunstreich, Timm/Lutz, Tilman/Mielich, Sinah/Muhl, Florian/Rosenkötter, Wolfgang/Schwagereck, Jorrit (Hg.) 2020: Dressur zur Mündigkeit? Über die Verletzung von Kinderrechten in der Heimerziehung. Weinheim
IGfH – Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen 2013: Stellungnahme der IGfH zum 14. Kinder- und Jugendbericht (Pressemitteilung). Frankfurt/M.
[1] Im Kontext der Beteiligung an der Fachtagung „1960 - 1980: Die bewegten und bewegenden Jahre in Ausbildung, Praxis und Wissenschaft der Sozialen Arbeit“, die vom 18.05. bis 20.05.2022 an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg im Fachbereich Soziale Arbeit stattgefunden hat, entstand die Broschüre Kontinuitäten, Brüche und Alternativen einer „Sozialarbeiteropposition“. Online unter: [https://akshamburg.wordpress.com/2022/09/16/kontinuitaten-bruche-und-alternativen-einer-sozialarbeiteropposition/]
[2] Diese Tagungs-Grundstruktur – Vorträge, Workshops, Diskussionsforen – haben wir für die Gliederung dieses Heftes beibehalten. Die beteiligten Autorinnen und Autoren haben allerdings nicht „protokollarisch“ ihre Veranstaltung reproduziert, sondern waren frei, die jeweils für sie wichtigen Aspekte hervorzuheben. Es sind also eher Reflexionen ihrer Beiträge.