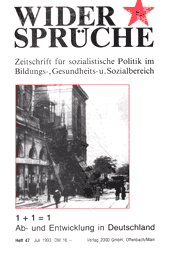1+1=1. Ab- und Entwicklung in Deutschland
Editorial
Was wäre gewesen, wenn...
Am 14. Januar 1990 beschließt die Ost-SPD ihren Ausstieg aus dem Oppositionsbündnis mit den Bürgerbewegungen.
In einem Kommentar vermerkt Konrad Weiß von "Demokratie jetzt" bitter und prophetisch: "Wir sind zusammen aufgebrochen und wollten den steinigen staubigen Weg gemeinsam gehen. Wir wollten dienen, nicht herrschen. Jetzt kündigt ihr die Seilschaft auf, hebt ab und macht euch aus dem Staub. Das macht die anderen stark, nicht uns. Wir alle müssen Demokratie doch erst lernen. Allein packt ihr es nicht, Freunde. Wenn ihr euch nicht besinnt, werden wir alle im Mai vor dem Trümmerhaufen unserer Hoffnung stehen. Und was uns die Geraer Stasi-Leute zugedacht hatten, werden wir uns selber getan haben: Wir werden paralysiert sein, also gelähmt und unfähig zum Handeln für unser Land." (TAZ vom 15.01.1990)
Was wäre gewesen, wenn die SPD damals (wie schon viele Male vorher und nachher) nicht umgefallen wäre, sich nicht bedingungslos dem Westestablishment untergeordnet hätte. Sicher wäre die Wahl, die Weiß noch für den Mai angesetzt hielt, aber schon (auf Drängen der SPD) am 18. März 1990 stattfand, nicht anders ausgegangen - aber: die Bürgerbewegungen zusammen mit SPD und der sich im Umbruch befindlichen PDS hätten eine satte Sperrminorität von gut 40% auf die Beine bringen können.
"Was wäre gewesen, wenn ..." Derart spekulative Fragen gelten als unhistorisch, unwissenschaftlich und naiv. Sei es drum. Sie sind aber zugleich auch so etwas wie Utopie im Sinne Blochs, nämlich in dem "Hier und Jetzt" schon das Andere, das in der herrschenden Wirklichkeit auch Mögliche nicht nur ahnen, sondern auch denken zu können. Das bedeutet auch, im geschichtlich Gewordenen nicht nur das zu sehen, was sich durchgesetzt hat, sondern auch das, was abgebrochen wurde, was sich im Geflecht herrschender Kräftefelder nicht hat entfalten können.
Daß meine Gedanken zu "Was wäre gewesen, wenn..." auch von der Hoffnung leben, daß die jetzige Resignation als Folge des Anschlusses nicht ewig dauern möge, möchte ich ebenso betonen, wie meinen Respekt und die Achtung vor denjenigen Rostocker Kolleginnen und Kollegen, die trotz dieses perversen Crash-Anschlusses aktiv und kreativ Kinder- und Jugendarbeit gestalten.
27. Juli 1995
Auf einer Klausurtagung des Jugendhilfeausschusses der Stadt Rostock, auf der über die weitere Perspektive der Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit nach der wahrscheinlichen "Vereinigung" am 3. Oktober 1995 diskutiert werden soll, (wahrscheinlich deshalb, da in der DDR sich immer stärker die Zweifel melden, ob eine Vereinigung beider deutscher Staaten jetzt schon sinnvoll sei), hält die Ausschußvorsitzende Sabine Hoffnung vom Bündnis 2000 ein Referat, in dem sie noch einmal die Entwicklung in den wichtigsten Bereichen der Kinder- und Jugendpolitik in Rostock Revue passieren läßt.
"...nachdem im Sommer 1990 klar war, daß die Sperrminorität aus den Oppositionsparteien den Anschlußvertrag nicht billigen würde, sah sich die De Mazière-Regierung gezwungen, den Kompromiß einzugehen, mit der BRD zunächst eine Konföderation zu bilden, die dann nach einer weiteren Volkskammerwahl im Herbst 95 zur Vereinigung beider deutscher Staaten führen sollte. An diesem Tag sollte zugleich über eine gemeinsame neue Verfassung abgestimmt werden. Ob das so sein wird, wird das Volk noch zu entscheiden haben. (Die allgemeinen Ausführungen zur Währungsunion, die im Sommer 1992 aufgrund des Zusammenbruchs der Sowjetunion relativ schnell beschlossen wurde, lasse ich hier aus, ebenso die Ausführungen über die wirtschaftliche Lage, die sich zwar nicht so katastrophal wie in Wirklichkeit, aber aufgrund der Erpressungspolitik der Kohl-Regierung doch ganz ähnlich verlief.)
Ihr erinnert euch alle sicher noch gut daran, daß das Scheitern von Krauses Anschlußpapier zu einer hohen Polarisierung in der Bevölkerung führte. Das hatte aber nicht nur negative Seiten, sondern auch positive. Nachdem sich im Herbst 1990 die alten Länder der DDR wieder gegründet hatten, kristallisierte sich dieser Konflikt zwischen den beiden Bevölkerungspolen an der Frage der Einführung der Dreigliedrigkeit ins Schulsystem oder der Weiterentwicklung der Einheitsschule dramatisch zu. Dieser Konflikt war in jeder Stadt, in jedem Landkreis von unterschiedlicher Heftigkeit, insbesondere an den Schulen selbst entwickelten sich die heftigsten Kämpfe. Sie waren dort um so schärfer, wo sich die Frage der Schulform mit der Frage der Entlassung politisch untragbarer, aber auch fachlich unqualifizierter Lehrerinnen und Lehrer verband. Ihr wißt alle, wie der Konflikt ausgegangen ist. Die Kultusbürokratie mußte ihre Vorstellung des anachronistischen dreigliedrigen Systems zurückziehen, ebenso ihren Anspruch über die Entscheidung, wer nun noch Lehrer sein darf und wer nicht. Die Befürworter einer offenen Gesamtschule, wie die Weiterentwicklung der EOS genannt wurde, setzte sich überall durch, auch wenn einige private Gymnasien gegründet wurden - von denen, die das für besser hielten. Gerade hier in Rostock erhielten wir für unsere Position sehr viel Unterstützung von englischen Kolleginnen und Kollegen der Community-School-Bewegung. Sie konnten viele Zweifler durch ihre Praxismodelle überzeugen, die ja auch viel besser an unsere DDR-Tradition der Einheit von Schul- und Jugendpolitik anschlössen. So sind heute die Schulen lebendige Orte, nicht nur des Lernens, sondern auch der Freizeitgestaltung, des Sports. Ja, in vielen Stadtteilen sind die Schulen zu kommunalen Mittelpunkten des Gesellschaftslebens geworden.
Die Öffnung der Schule nach innen und außen hat ganz sicherlich dazu beigetragen, daß die Tatsache, daß von den 96 Jugendclubs in der Hansestadt im Sommer 1990 schon über die Hälfte geschlossen waren, nicht zu einer dramatischen Zuspitzung im Jugendbereich führte: Viele Cliquen und autonome Gruppen bekamen Räume in Schulen zur Verfügung gestellt. Die verbleibenden 37 Jugendclubs wurden in die Stiftung "Jugend in Rostock" überführt. Ihr erinnert euch sicher noch an die erbitterten Auseinandersetzungen, die um die Organisationsform und Leitung dieser Stiftung geführt wurden. Der Kompromiß, uns, den Jugendhilfeausschuß, als Aufsichtsgremium zu bestellen und dem Rostocker Stadtjugendring das Recht zuzugestehen, die Geschäftsführung zu bestimmen, hat sich als sehr sinnvoll erwiesen. Aus dem Verkauf von 12 großen Jugendclubs an private Investoren konnte die Stiftung sowohl Stellen als auch andere, kleinere Räume finanzieren, so daß Rostock von sich behaupten kann, daß unseren Jugendlichen mehr und mehr unterschiedliche Räume zur Verfügung stehen als vorher - vor der Wende. Das Modell Stiftung war also so erfolgreich, daß es als Rostocker Modell in die Jugendpolitik eingegangen ist. Auch wenn jetzt mit der Stadt hart um Zuschüsse gerungen werden muß (angesichts der finanziellen Misere), so ist doch wichtig, daß offene Jugendarbeit bei uns auf eigene Ressourcen zurückgreifen kann.
"Der größte Kampf muß um die Achtung des Kindes geführt werden" - dieser Ausspruch des italienischen Kollegen Malaguzzi könnte über der Entwicklung der Kinderhäuser stehen - und auch über den Auseinandersetzungen, die wir darum geführt haben und noch führen. Dabei betrachte ich die Tatsache, daß heute nicht mehr von Kindergarten oder Kindertagesheim oder Kindertagesstätte gesprochen wird, sondern - wie selbstverständlich - von Kinderhäusern als einen deutlichen Hinweis darauf, daß das gesellschaftliche Verständnis von Kindheit sich auch bei uns deutlich gewandelt hat.
Durch die Aktivierungen im Schul- und Jugendbereich war es eigentlich völlig klar, daß davon der Kinderbereich nicht unberührt bleiben konnte. Als der Senat immer mehr Tagesstätten und Kindergärten schließen mußte bzw. meinte es zu müssen und die Preise für die Kinderbetreuung (welch schreckliches Wort) immer wieder heraufsetzte, kam es im Sommer 1993 zu einer regelrechten Revolte. Die Eltern von 15 KTHen beschlossen, ihr Geld auf ein Sperrkonto zu überweisen, denn sie wollten sichergehen, daß ihr Geld wirklich nur für ihr Kinderhaus genutzt wurde. Mit den Leitungen dieser Kindertagesheime einigten sie sich darauf, daß man gemeinsam eine pauschale Finanzierung der Kinderhäuser durch die Stadt fordern wollte. Dieser Konflikt führte zu einer völlig neuen Organisationsform der Kinderhäuser: Sie gingen in Verwaltungs- und Organisationshoheit von "Kinderkooperativen" über (Kooperationen von Eltern, Erzieherinnen und interessierten Bürgerinnen), die dank des neuen, am italienischen Recht ausgerichteten Genossenschaftsrecht schnell zu gründen waren. Der Staat sicherte jedem Kinderhaus eine Basisfinanzierung zu, die im Rahmen der geplanten Gesamtsumme für den Kinderbetreuungsbereich lag. Diese Festfinanzierung wird - das ist das Neue daran - von den Genossenschaftsanteilen der Eltern finanziell und materiell ergänzt, d.h. diejenigen Eltern, die statt Geldleistungen lieber Sach- und Arbeitsleistungen bringen, können dies im Rahmen der jeweiligen Jahrespläne tun. Diese Jahrespläne werden von jedem Kinderhaus, bzw. dessen Kooperative gemeinsam gestaltet. Auch hier hatten wir Unterstützung von außen. Ich erinnere an die aufopfernde Beratungs- und Fortbildungsarbeit unserer italienischen Kolleginnen aus Reggio Emilia.
Die Ansätze, die früher verstaatlichen Bereiche jetzt real zu vergesellschaften waren der entscheidende politische Prozeß, der es ermöglichte, die Lähmung nach der Anschlußdiskussion erfolgreich zu durchbrechen. Heute kommt es mir vor wie ein Trauma, das wir abschütteln mußten, um uns nicht nur über die Stasi-Verstrickungen auseinanderzusetzen, sondern auch über die zukünftige Gestaltung vergesellschafteter Sektoren unserer Stadt.
Diese Strategie: Vergesellschaftung statt Verstaatlichung und Bürokratisierung war auch in zwei anderen Bereichen erfolgreich, um die uns mittlerweile auch einige westdeutsche Gemeinden beneiden: Die Schiedskommissionen und die Kinder- und Jugendhilfekommissionen in den Stadtbezirken.
Nachdem es nicht gelungen war, die Konfliktkommissionen in den Betrieben zu erhalten, war es von um so größerer Bedeutung, die Schiedskommissionen in den Stadtteilen auf eine neue Basis zu stellen. Hier kamen uns Untersuchungsergebnisse aus Westdeutschland sehr entgegen, die sich für eine Entkriminalisierung insbesondere jugendlicher Verfehlungen gegen das Strafgesetz stark machten. Was dort unter dem Begriff "Diversion" mehr schlecht als recht läuft, konnten wir hier im Rahmen der gesellschaftlichen Gerichte deutlich weiterentwickeln, so daß wir heute sagen können, daß es nur sehr wenige Jugendliche gibt, die mit repressiven Mitteln sanktioniert werden müssen - über 90% aller Jugendstrafsachen werden von den Schiedskommissionen geregelt: Hier steht Wiedergutmachung, Ausgleich und Entschuldigung an oberster Stelle. Ähnlich verlief die Auseinandersetzung um die Kinder- und Jugendhilfekommissionen. Auch hier gab es erstmal lebhafte Debatten um die Zusammensetzung, wie sie Anfang 1990 in den damaligen Jugendhilfekommissionen noch vorzufinden war. Viele Mitglieder der Kommissionen wurden als politisch nicht tragbar nicht wiederbenannt, andere ausdrücklich bestätigt, die meisten aber sind neu in die Kommissionen hinzugewählt worden, was ja auch notwendig war, da diese Kommissionen nun auf Stadtteilebene angesiedelt sind. Diese - im westdeutschen Jargon "Laienhelferlnnen" - verfügen über soviel Kompetenz und über von der Kommune bereitgestellte Ressourcen (Wohnungen, Häuser etc.), daß die großen Heime - wenn auch zum Teil gegen den harten Widerstand der dort Beschäftigten - jetzt alle aufgelöst bzw. umgewandelt sind. Aber auch hier gab es Anregungen aus Westdeutschland, wo die Jugendhilfen nach dem dortigen KJHG ja 1990 auch neu strukturiert werden mußten. Ambulante und stationäre Hilfen leisten wir nach dem Konzept "Aus einer Hand", d.h. jede Jugendhilfekommission wird von einer oder mehreren Einrichtungen freier Träger unterstützt, die entsprechende professionelle Hilfen bereithalten - von der Erziehungsberatung über Unterstützungshilfen bis hin zu vielen Formen betreuten Wohnens. Diese neue Form arbeitet sogar kostengünstiger als der aufgeblähte bürokratisierte Professionellenapparat in den Gebieten der BRD.
Abschließend möchte ich noch einmal an den großen Konflikt von August/September 1992 erinnern: Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie der Konflikt ausgegangen wäre, wenn wir nicht diese Demokratiebewegung in vielen gesellschaftlichen Feldern gehabt hätten. Bestimmt wäre die ZAST von den aufgebrachten Jugendlichen und Bürgern Lichtenhagens gestürmt worden. Bestimmt wären Flüchtlinge ein weiteres Mal zu Opfern gemacht worden, wie das ja so häufig in Westdeutschland passiert. Ich bin jetzt noch stolz, daß vor allem die Jugendlichen die 200 Roma, die vor dem Haus lagern mußten, in ihre Mitte nahmen und - in einem anschwellenden Demonstrationszug - zum Rathaus brachten und sie in den dortigen Amtsräumen einquartierten. Hier muß ich mal die Polizei loben, die sich darauf beschränkte, den zum Erliegen gekommenen Verkehr umzuleiten und nicht - wie viele von uns ja befürchteten - das Ganze zu einer großen Gewaltorgie zu machen. Das damit das Problem der Flüchtlinge - oder wohl besser: unser Problem mit den Flüchtlingen - nicht gelöst ist, ist klar, aber es war ein deutliches Signal, die Opfer nicht noch ein weiteres Mal zum Opfer zu machen.
Anstatt des sonst üblichen Editorials erscheinen hier Gedanken unseres Redaktionsmitgliedes Timm Kunstreich zu einer verlorenen Zukunft - am Beispiel der Kinder- und Jugendpolitik in Rostock. Mit diesem Heft knüpfen wir thematisch an unseren Nummern "Im Osten nichts Neues?" (Heft 18) und "Verlust und Befreiung" (Heft 37) an.