Heft 76: Zivilgesellschaft von oben – Regulation der Kooperation
![]() 2000 |
Inhalt
| Editorial
| Leseprobe
2000 |
Inhalt
| Editorial
| Leseprobe
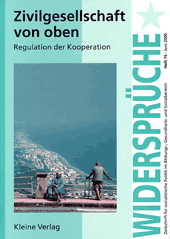
- Juni 2000
- 120 Seiten
- EUR 11,00 / SFr 19,80
- ISBN 3-89370-338-1
"Zivilgesellschaft"
Von der Vergesellschaftung der Politik zur Privatisierung der Gesellschaft
Der Begriff der Zivilgesellschaft ist mittlerweile in aller Munde. Während der achtziger Jahre kam er über die Oppositionellen Osteuropas zu den Intellektuellen im Westen. Dort stand er zwar vage, aber doch noch politisch identifizierbar für die Umorientierung der Linken weg von Klasse und Staat, hin auf soziale Bewegungen, Selbstorganisation und politische Öffentlichkeit. Das änderte sich in den neunziger Jahren: Ob der Bundespräsident in Festtagsreden das karitative Engagement von Bürgern lobt, Wirtschaftsverbände den Abbau des Sozialstaates fordern oder Schröder seine wirtschaftsfreundliche Politik der "Neuen Mitte" programmatisch veredeln möchte, die Zivilgesellschaft ist immer mitten dabei.
Popularität und Klarheit verhalten sich in dieser Erfolgsgeschichte allerdings umgekehrt proportional zueinander. Unumstritten ist nur, dass die Zivilgesellschaft einen Bereich freiwilliger Zusammenschlüsse und Initiativen zwischen Privatbereich und Staat bezeichnet, dem allerlei positive Effekte zugeschrieben werden (vgl. die im Text aufgeführten Definitionen).
Derartige Unschärfen sind die Regel, wenn ein politischer Begriff zur Parole des Zeitgeistes wird. Im Falle der Zivilgesellschaft liegen unterschiedliche, ja gegensätzliche semantische Bedeutungen aber auch schon deshalb nahe, weil der Begriff aus rivalisierenden ideengeschichtlichen Traditionen stammt. Der folgende Beitrag wird die Begriffs- und Ideengeschichte thematisieren, aber nur soweit, wie es mir erforderlich scheint, um die politischen Probleme seiner derzeitigen Verwendung besser beleuchten zu können. Meine Hauptthese wird lauten, dass, entgegen den mit seiner Wiederentdeckung ursprünglich verbundenen Intentionen, der Begriff der Zivilgesellschaft heute zum Vehikel einer weiteren Funktionalisierung und Entpolitisierung der Gesellschaft zu werden droht.
Die Entdeckung der Zivilgesellschaft als politischer Handlungsraum
Zunächst ist jedoch festzuhalten, dass die während der achtziger Jahre einsetzende Entdeckung der Zivilgesellschaft aufs engste mit der Hoffnung auf neue politische Handlungsmöglichkeiten verbunden war. Das gilt zunächst einmal für die Länder Ostmitteleuropas, in denen die intellektuelle Opposition eine Demokratisierung des Sozialismus nach dem Scheitern des Prager Frühlings nicht länger von innerparteilichen Reformern erwartete, sondern daran ging, um ein "unabhängiges Leben der Gesellschaft" (Vaclav Havel) zu kämpfen. Selbstverständlich war dieser Aufbau von Gegenstrukturen in einem Herrschaftssystem, das den Anspruch erhob, alle Lebensbereiche seinen übergeordneten Zielsetzungen zu unterwerfen, eminent politisch. Das galt für unabhängige Gewerkschaften ebenso wie für Menschenrechtsgruppen, Samisdatpublikationen oder kirchliche Friedensgruppen. Die "zweite", "unabhängige" oder wie sie relativ spät dann auch genannt wurde, die "zivile Gesellschaft" konnte in einem emphatischen Sinne als selbstbestimmt gelten, solange es ihr nur gelang, sich dem direkten Zugriff der Einparteienherrschaft zu entziehen. Das Verhältnis der entstehenden Strukturen und Handlungsräume zur Ökonomie und zu institutionalisierten Formen der Politik brauchte vor dem Zusammenbruch des Kommunismus nicht sonderlich zu interessieren. Allein ihre Existenz bestritt den Führungsanspruch der Partei und unterhöhlte deren Legitimation.
In Westeuropa und Nordamerika ging die Übernahme des Begriffs der Zivilgesellschaft zeitlich mit der Distanzierung der Linken vom Marxismus einher. Kritiker dieser Entwicklung wie Wolf-Dieter Narr und Joachim Hirsch haben sie als ein Phänomen der Resignation, als Abschied von einer gesellschaftsverändernden Perspektive angeprangert (etwa Hirsch 1997; Narr 1991). Der damit erhobene Vorwurf des intellektuellen Opportunismus übersieht jedoch, daß ganz im Gegenteil die Umorientierung der Linken auf eine Stärkung der Zivilgesellschaft praktische Handlungsmöglichkeiten versprach, die ein auf Kapitalismuskritik und Klassenkampf setzender Marxismus nur noch in längst lächerlich gewordenen historischen Kostümierungen, als Parodie auf den Klassenkampf vergangener Zeiten anzubieten hatte. Die in den siebziger und achtziger Jahren entstandenen Initiativen und Bewegungen konnten plausibel als eine in sich plurale gesellschaftliche Gegenmacht interpretiert werden, von der aus sich staatliches Handeln zwar indirekt, aber doch wirkungsvoller beeinflussen ließe als über die vermachteten Parteien und Verbände. Und gegen die Resignation der systemtheoretischen "Aufklärung", die an die Stelle politischer Perspektiven das Fortschreiten der funktionalen Ausdifferenzierung von Teilsystemen setzt, verband sich mit einem zivilgesellschaftlichen Demokratieverständnis der Anspruch, in den Netzwerken und Teilöffentlichkeiten einen Ort zu bestimmen, von dem aus die Gesellschaft reflexiv auf sich selbst einwirken könne, auch ohne sie als einheitliches Kollektivsubjekt vorstellen und organisieren zu müssen. Schließlich lässt sich mit einigem Recht behaupten, dass gerade die deutsche Linke erst im Zusammenhang mit der zivilgesellschaftlichen Umorientierung die marxismustypische Auflösung des Politischen in ökonomische Interessen aufgab und Politik als eigenen Handlungsbereich entdeckte.
Allerdings stand der zivilgesellschaftliche Diskurs von Beginn an im Zeichen zweier grundsätzlicher Unklarheiten. Die erste betrifft das Verhältnis der zivilgesellschaftlichen Strukturen zur Politik im engeren Sinn, d.h. zur politischen Willensbildung und zum Handeln staatlicher Institutionen. Der Anti-Institutionalismus der zivilgesellschaftlichen Orientierung blendet aus, wie sich gesellschaftliche Meinungsbildung in politische Entscheidungen und staatliches Handeln umsetzen lässt. Die zweite, von marxistischen Kritikern gern unterstrichene Schwäche der zivilgesellschaftlichen Orientierung liegt in der Herauslösung des öffentlichen Handlungsraumes aus sozialen und ökonomischen Bezügen. Liberale, kommunitaristische und diskurstheoretische Ansätze charakterisieren bei allen Unterschieden die Zivilgesellschaft als Raum des Verkehrs zwischen Freien und Gleichen. Unklar bleibt, wie weit es hier um ein normatives Verständnis oder um die analytische Charakterisierung eines von der Ökonomie zu unterscheidenden Handlungsraumes geht. Um dem Vorwurf zu begegnen, dem - marxistisch gesprochen - ideologischen Schein der bürgerlichen Gesellschaft aufzusitzen, wäre sowohl normativ wie analytisch das Verhältnis der Zivilgesellschaft zur sozioökonomischen Ungleichheit zu bestimmen. Beide Unklarheiten lassen sich nun allerdings nicht ohne weiteres beseitigen. Sie sind nicht nur dem Konzept der Zivilgesellschaft immanent, sondern reflektieren auch ein grundlegendes Problem der modernen Gesellschaft. Dieser Zusammenhang lässt sich am besten durch einen kurzen Exkurs in die Begriffsgeschichte verdeutlichen. Dazu müssen wir allerdings sehr weit, nämlich bis zur politischen Philosophie des Aristoteles zurückgehen.
Politische, wirtschaftliche oder assoziative Zivilgesellschaft
Aristoteles bestimmt den Menschen bekanntlich als zoon politikon (Aristoteles 1994: 1253 A). Im Lateinischen wurde daraus das animal sociale, der Mensch als ein soziales, auf Zusammenleben mit anderen hin angelegtes Lebewesen. Diese Lesart nimmt der aristotelischen Position jedoch ihre eigentliche Pointe. Wenn Aristoteles die menschliche Natur als politisch bestimmt, so meint er damit, dass unter den empirisch vorfindbaren Gemeinschaften eine in ganz besonderer Weise der Natur des Menschen entspricht, nämlich die koinonia politike, die herrschaftsfreie Assoziation freier und gleicher Bürger. Diese politische Gemeinschaft heißt in der lateinischen Übersetzung societas civilis, englisch civil society und im Deutschen ursprünglich bürgerliche Gesellschaft. Bleiben wir jedoch erst einmal bei Aristoteles. Seine koinonia politike bezeichnet eine Form des politischen Zusammenlebens, die sich von Herrschaft im deutschen Wortsinn grundsätzlich unterscheidet. Wenn wir im Deutschen von verschiedenen politischen Gemeinwesen als Herrschaftsformen sprechen, etwa von der Demokratie, der Monarchie oder Aristokratie, verwischen wir, worum es Aristoteles mit seiner Bürgergesellschaft ging: nämlich um ein Gemeinwesen ohne Herrschaft. Im deutschen Begriff der Herrschaft steckt der Herr, und wo es einen Herr gibt, gibt es logischerweise auch Knechte. Anders gesagt, das Politische wird nach dem Muster der Befehls-Gehorsamsbeziehung gedacht. Von einer solchen asymmetrischen Beziehung wollte Aristoteles seine Idealform des politischen Zusammenlebens aber gerade abgrenzen. Herrschaft hatte für ihn ihren Platz im Haushalt, im Verhältnis des Patriarchen zu Frau, Kindern und Sklaven. Darauf bezogen spricht er von Despotie, politisch dagegen nennt er das Regieren unter Freien und Gleichen. Deren Verhältnis untereinander beruht nicht auf Gewalt und Unterdrückung, sondern auf Recht und wechselseitiger Anerkennung. Die eigentlichen Herrschaftsverhältnisse des Haushalts werden von Aristoteles dagegen naturalisiert und bleiben aus seinem Politikbegriff ausgeklammert. Insofern lässt sich die aristotelische Sicht der Polis nicht auf heutige Gesellschaften übertragen. Freiheit, Gleichheit, die Verkehrsform des Rechts sowie Autonomie oder Selbstbestimmung bilden dennoch entscheidende Charakteristika der aristotelischen Bürgergesellschaft, die sich bis heute in allen Versionen der Zivilgesellschaft als normative Elemente wiederfinden lassen.
Im Gegensatz zur republikanischen, auf Aristoteles zurückgehenden Tradition wird in der Neuzeit die Zivilgesellschaft oder societas civilis nicht mehr mit der politischen Gemeinschaft oder dem Staat identifiziert, sondern ihm vorausgesetzt oder gar entgegengestellt. Das lässt sich am besten am Denken John Lockes verdeutlichen. Seine Kritik am absolutistischen Staat basiert auf der Annahme eines vorpolitischen gesellschaftlichen Naturzustandes. In diesem Zustand produzieren und tauschen die Menschen und orientieren sich an ihrer natürlichen Vernunft (vgl. auch Taylor 1991). Sie sind insofern gleich, als sie keine Privilegien genießen und zwischen ihnen keine Autoritätsverhältnisse vorausgesetzt werden können. Eine politische Gemeinschaft gründen sie qua Vertrag, um die Sicherheitsmängel des Naturzustandes zu beheben. Unschwer scheint durch Lockes Argumentation die bürgerliche Gesellschaft im sozialökonomischen Sinne durch, die bereits als Wirtschaftsgesellschaft integriert ist, aber eines positiven Rechts und staatlichen Schutzes bedarf. In der weiteren Entwicklung des liberalen Denkens bezeichnet Zivil- oder bürgerliche Gesellschaft dann nicht mehr die politische Gemeinschaft, sondern diesen vorpolitischen Bereich. Er gilt nun als Ort der Freiheit und Gleichheit, der gegen staatliche Übergriffe zu schützen ist. Freiheit bezeichnet nun auch nicht mehr die aktive Mitgestaltung der res publica, sondern beginnt für den Bürger dort, wo die Politik aufhört.
Schon bald nach Locke, und lange vor Marx, nimmt das politische Denken einen grundlegenden Widerspruch dieser vorpolitischen Gesellschaft wahr: Sie ist eben nicht nur ein Bereich der Freiheit, Gleichheit und der natürlichen Vernunft, sondern ein Ort der Konkurrenz, der sich wechselseitig instrumentalisierenden Partikularinteressen, der ökonomischen Ungleichheit und der Entfremdung. Dagegen richtet sich Jean-Jacques Rousseaus Vorstellung, durch eine an der antiken Polis orientierte Wiederherstellung des Primats der Politik die Vermögensdifferenzen demokratisch zu begrenzen und die Dynamik der freigesetzten Produktions- und Bedürfnisentwicklung durch den politischen Souverän zu kontrollieren. Dazu bedarf es eines allgemeinen Willens, der volonté générale, der sich der Einzelne unterzuordnen hat. Die Republik Rousseaus konstituiert sich als Moral- oder Kollektivkörper. Die antiplurale Tendenz dieser Lösung, ihre Anfälligkeit für eine gewaltsame Durchsetzung des postulierten Allgemeinwohls ist hinreichend bekannt. Und obwohl Marx meinte, eine herrschaftsfreie Aussöhnung von Allgemein- und Partikularinteresse könne gelingen, wenn man den Idealismus Rousseaus überwinde und in den materiellen Verhältnissen der Produktion die Grundlagen von Egoismus und Ungleichheit beseitige, hat gerade der Sozialismus den totalitären Kern der erstrebten Wiederherstellung einer Einheit von Allgemein- und Partikularinteresse freigelegt.
Gegen Rousseau setzten die liberalen schottischen Moralphilosophen nicht auf eine Wiederbelebung der antiken Polis, sondern auf gesellschaftsimmanente Kräfte als Gegengewicht zum Egoismus der Individuen (vgl. dazu Seligman 1992). Sprichwörtlich ist die "unsichtbare Hand", von deren wohltuender Wirkung Adam Smith erwartet, dass sie die Verfolgung von Einzelinteressen in einem quasi automatischen Prozess in die Förderung des Allgemeinwohls verwandelt. Über Smiths berühmtem Zitat wird allerdings gern übersehen, dass die klassischen Liberalen nicht auf einen systemischen Prozess im modernen Sinn setzten. Die ökonomische Aktivität selbst hat bei Smith nämlich einen ethischen Grund, sie ist Ausdruck des Bedürfnisses der Menschen nach sozialer Anerkennung. Das erlaubt es ihm, "natürliche Sympathie" und "ethische Gefühle" (moral sentiments) als Gegenkräfte zu einer wechselseitigen Instrumentalisierung der Individuen zu benennen. So kann er (theoretisch) Ethik und Ökonomie in der (Wirtschafts-)Gesellschaft selbst zusammenführen. Der positiven Anthropologie der Aufklärung, die hinter dieser Einbettung instrumenteller Vernunft in eine Ethik wechselseitiger Anerkennung steht, werden wir nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts kaum mehr zustimmen können. Lange zuvor zeigte aber schon die sozialökonomische Entwicklung kapitalistischer Gesellschaften, daß eine solche Synthese innergesellschaftlich nicht geleistet wird. Der Kapitalismus schafft Reichtum, indem er dessen "Springquellen, die Erde und den Arbeiter" untergräbt (Marx).
Eine dritte Traditionslinie des politischen Denkens siedelt die Zivilgesellschaft in einer Sphäre zwischen Wirtschaftsgesellschaft und Staat an. Dafür lassen sich Anhaltspunkte in den unabhängigen Körperschaften, den corps intermediaire bei Montesquieu finden, vor allem aber im Denken Charles de Tocquevilles. In seiner Analyse der Demokratie in den Vereinigten Staaten beschreibt Tocqueville die freiwilligen Assoziationen der Bürger als entscheidende Innovation der amerikanischen Demokratie. Nicht zuletzt ihnen sei es zu verdanken, dass Amerika das französische Schicksal eines nachrevolutionären Scheiterns der Demokratie erspart blieb. Unter den Bedingungen einer auf rechtlicher und politischer Gleichheit basierenden Gesellschaft ersetzen Assoziationen die Körperschaften und den Adel des Ancien Régime in deren Funktion als machtpolitisches Gegengewicht zur zentralen Herrschaftsinstanz und vermindern so die in der Demokratie stets drohende Gefahr einer Mehrheitsdespotie. Assoziationen erleichtern es Minderheiten, sich zu artikulieren und die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen. Darüber hinaus relativieren sie den Privatismus der auf individuellen Erwerb konzentrierten Bürger und sorgen für die gewohnheitsmäßige Verinnerlichung einer den Horizont des Eigeninteresses übersteigenden Gemeinwohlorientierung.
Ambivalenzen und aktueller Bedeutungswandel der Zivilgesellschaft
Die hier nur kurz skizzierten unterschiedlichen Anknüpfungspunkte des Begriffs in der Geschichte des politischen Denkens erschweren seine exakte Verwendung und tragen erheblich dazu bei, dass der rhetorische Rekurs auf die Zivilgesellschaft für alle möglichen Zwecke instrumentalisiert werden kann. Die normative und auf eine Erweiterung von Partizipationsmöglichkeiten gerichtete Demokratietheorie knüpft allerdings vorwiegend an der obigen dritten Tradition an. Sie schreibt der Zivilgesellschaft, ähnlich wie Tocqueville den Assoziationen, eine eigene, von Staat und Wirtschaft zu unterscheidende Logik zu. Das läßt sich in einigen Funktionen konkretisieren.
- Die Zivilgesellschaft soll einen Raum der öffentlichen Meinungs- und Willensbildung darstellen und mit der Vielfalt ihrer Vereinigungen, Bewegungen und Initiativen die Politik an die Lebenswelt der Bürger zurückbinden. Sie wird beschrieben als ein Ort der Auseinandersetzung um kollektive Orientierungen, um Werte und um den Wandel von Weltbildern. Derart allgemein gefaßt, können damit sowohl die von Habermas ausgehenden Befürworter einer deliberativen Demokratie, libertäre Ansätze, aber auch die auf Gramscis Konzeption der Hegemonie zurückgreifenden Theorien übereinstimmen. Umstritten bleibt allerdings, inwieweit die Zivilgesellschaft einer gemeinsamen Identität der Bürger sowie eines Konsenses bedarf, der über Verfahren hinausgeht.
- Die Zivilgesellschaft soll zur Inklusion von Minderheiten beitragen und die advokatorische Artikulation von Belangen ermöglichen, die schlecht organisierbar und in Parteien und Verbänden nur unzureichend repräsentiert sind.
- Die Zivilgesellschaft soll Konflikte "zivilisieren" und einen aktiven Bürgersinn hervorbringen. Das bedeutet zum einen, dass Konflikte gewaltfrei ausgetragen werden. Zum zweiten soll es durch die Erfahrung gewaltfreier Konfliktlösung zur Anerkennung der Rechte des Gegners und zur Bindung an einen gemeinsamen politischen Raum kommen. In welchem Maße darüber hinaus ein spezifisches Ethos und "Bürgertugenden" gewünscht sind bzw. für möglich gehalten werden, ist im Zusammenhang mit den oben genannten Kontroversen über Konsens und kollektive Identität umstritten.
- Schließlich soll die Zivilgesellschaft durch vielfältige Formen kollektiver Selbstorganisation Solidarität fördern und zur sozialen Sicherheit beitragen. Sie verspricht Lösungen sozialer Probleme jenseits der entmündigenden Logik staatlicher Bürokratien und der Konkurrenz des Marktes. Umstritten bleibt allerdings, ob aus dem Abbau staatlicher Verantwortung selbstbestimmte gesellschaftliche Strukturen hervorgehen können oder ob damit doch nur neue Bereiche für die gewinnorientierte Marktökonomie erschlossen werden.
Für eine Beurteilung der genannten Funktionen und damit für eine Beurteilung des Beitrags zivilgesellschaftlicher Strukturen zur weiteren Demokratisierung westlicher Gesellschaften ist zunächst deren Verhältnis zu den institutionalisierten Formen der politischen Willensbildung und damit das erste der beiden oben genannten Probleme zu betrachten. Insbesondere die Funktionen der Öffentlichkeit und der Inklusion setzen m.E. ein gemeinsames, klar umgrenztes politisches Gemeinwesen voraus. Die plurale Öffentlichkeit der Zivilgesellschaft kann nur in dem Maße politisch integrieren und zur politischen Willensbildung beitragen, wie sie auf ein institutionalisiertes staatliches Gegenüber bezogen bleibt. Die Netzwerke der Zivilgesellschaft unterscheiden sich von Expertenzirkeln oder Interessenverbänden nur so weit, wie sie ihre Anliegen und Meinungen zur öffentlichen Diskussion und, in letzter Instanz, auch zur demokratischen Disposition stellen. Nur durch einen solchen Bezug auf gemeinsame Entscheidungen betätigen sich die Individuen in der zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit als Bürger eines Gemeinwesens. Ohne Verzahnung von Öffentlichkeit und institutionalisierter politischer Willensbildung unterschieden sie sich nicht von Teilnehmern einer chat group, Gästen einer Talkshow oder Experten auf einer wissenschaftlichen Konferenz. Von der Möglichkeit der politischen Partizipation bliebe wenig mehr als das berühmte Rauschen im Äther. Etwas traditioneller lässt sich auch formulieren: der Bürger der Zivilgesellschaft ist ohne Bezug auf eine gemeinsame Sache, die res publica, nichts anderes als der Bourgeois der bürgerlichen Gesellschaft.
Das zweite Problem, das Verhältnis des zivilgesellschaftlichen Handlungsraumes zur sozioökonomischen Ungleichheit der Wirtschaftsgesellschaft wird durch den Bezug auf die politische Willensbildung nicht gelöst. Wie die Bürger ihren im öffentlichen Raum artikulierten Anspruch auf Selbstbestimmung gegenüber einer systemisch verselbständigten Ökonomie durchsetzen können, bleibt offen. Der zivilgesellschaftliche Diskurs hat zur alten Frage nach der Veränderbarkeit des kapitalistischen Wirtschaftssystems wenig beizusteuern. Eine politische Zivilgesellschaft kann zur Demokratisierung der Input-Seite staatlicher Politik beitragen und so die wirtschaftspolitischen Regulierungsleistungen enger an die Meinungsbildung über gesellschaftliche Ziele und Prioritäten anbinden. Die Zähigkeit, mit der mächtige Interessen staatliches Handeln auch gegen gesellschaftliche Mehrheiten aufhalten oder verlangsamen können, zeigt jedoch schon ein kurzer Blick auf die Geschichte des Atomausstiegs. Die längst bestehende gesellschaftliche Mehrheit für den Atomausstieg scheint kaum in wirkungsvolle politische Maßnahmen umzusetzen zu sein. Noch nüchterner sollten die Möglichkeiten gesehen werden, wirtschaftliche Prozesse am Staat vorbei direkt durch gesellschaftliche Initiativen zu beeinflussen. Das mag im Einzelfall spektakulärer Konsumentenboykotte gelingen, ist als generelle Methode der Regulierung ökonomischer Prozesse aber gewiss unrealistisch. Schließlich ist in diesem Zusammenhang auch die soziale Selektivität zivilgesellschaftlicher Zusammenhänge zu beachten. Die zeitlichen und persönlichen Voraussetzungen für eine Beteiligung an gesellschaftlichen Initiativen sowie die Möglichkeiten der Einflussnahme auf öffentliche Diskurse sind mit Sicherheit sozial ungleich verteilt. Polemisch gesagt ist die Zivilgesellschaft ein attraktives, erfolgversprechendes Feld der Intervention für den prominenten Intellektuellen oder auch für die hochmotivierte, über Zeit und Medienzugang verfügende Bürgerinitiative. Die Interessen der Lohnabhängigen dürften allerdings in den hergebrachten Interessenverbänden und ihrer korporatistischen Politik besser aufgehoben sein als in den deliberativen Netzwerken der Zivilgesellschaft.
Die neuere Konjunktur des Begriffs der Zivilgesellschaft scheint mir jedoch vor allem dort problematisch, wo sie die Bindung an gemeinsame politische Institutionen aufgibt und "transnationale zivilgesellschaftliche Netzwerke" als attraktive Alternative zur nationalstaatlich verfaßten Demokratie ins Spiel bringt. Beispielhaft für diese Tendenz stehen die zahlreichen Schriften von Ulrich Beck. Als Ergebnis der Globalisierung konstatiert dieser eine "Befreiung der Demokratie aus dem Container des Staates" (Beck 1998: 13) und feiert die Akteure von Greenpeace oder den Käuferboykott französischen Rotweins nach den Atomwaffenversuchen im Pazifik als weltweite direkte Demokratie bzw. als realisiertes Weltbürgertum (vgl. Beck 1997: 124). Nichts gegen solche Initiativen. Wer aber der Auflösung bestehender politischer Gemeinschaften zugunsten der Netzwerke von Nichtregierungsorganisationen das Wort redet, sollte eine genauere Bilanz des Gewinns und Verlusts an politischen Einfluss- und Handlungsmöglichkeiten aufmachen und darin nicht nur die Prominenz der internationalen Expertengruppen berücksichtigen. Die Beschwörung der Zivilgesellschaft zieht ihre Faszination nicht zuletzt aus der alten Utopie einer Auflösung des Staates in die Gesellschaft. Dieses Geschäft besorgen im Zeitalter der Globalisierung aber schon ganz andere Kräfte. Vor diesem Hintergrund ist zu befürchten, dass die zivilgesellschaftliche Orientierung in dem Maße, in dem sie ihre Bindung an das Ideal der republikanischen Selbstregierung aufgibt, zur emanzipatorischen Begleitmusik einer Privatisierung der Welt unter kapitalistischem Vorzeichen wird.
Literatur
Angehrn, Emil 1992: Zivilgesellschaft und Staat. Anmerkungen zu einer Diskussion. In: Jahrbuch Politisches Denken. Stuttgart, Weimar, S. 145-158
Aristoteles 1994: Politik. Reinbek
Beck, Ulrich 1997: Was ist Globalisierung? Frankfurt/Main
Beck, Ulrich 1998: Wie wird Demokratie im Zeitalter der Globalisierung möglich? Eine Einleitung. In: ders.: Politik der Globalisierung. Frankfurt/Main, S. 7-67
Hirsch, Joachim 1997: Von der "Zivil"- zur "Bürgergesellschaft". Etappen eines unaufhaltsamen Abstiegs. In: Fuchs, G.; Moltmann, B.; Prigge, W.; Rexroth, D.: Frankfurter Aufklärung. Frankfurt/Main, New York, S. 151-160
Kneer, Georg 1997: Zivilgesellschaft. In: ders.: Soziologische Grundbegriffe. München, S. 228-251
Narr, Wolf-Dieter 1991: Vom Liberalismus der Erschöpften. In: Blätter für deutsche und internationale Politik 2, S. 216-227
Riedel, Manfred 1979: Gesellschaft, bürgerliche. In: Brunner, O.; Conze, W.; Koselleck, R.: Geschichtliche Grundbegriffe. Stuttgart, S. 719-800
Rieff, David 1999: The False Dawn of Civil Society. In: The Nation, February, 22nd
Seligman, Adam 1992: The Idea of Civil Society. The Free Press, New York
Taylor, Charles 1991: Die Beschwörung der Civil Society. In: Michalski, K.: Europa und die Civil Society. Stuttgart, S. 52-84
Definitionen
"Die Bürgergesellschaft ist eine Gesellschaft, in der eine Vielfalt autonomer Institutionen und Organisationen aufrechterhalten wird durch den Bürgersinn ihrer mit Rechten ausgestatteten Mitglieder, die daher Bürger im weitesten und tiefsten Sinne sind ...Die Bürgergesellschaft hat bestimmte Charakteristika. Man kann wahrscheinlich viele aufzählen, ich erwähne hier drei: Pluralität, Autonomie, Zivilität" (Ralf Dahrendorf: Die Zukunft der Bürgergesellschaft, in: FR, 24.1.1992).
"Den institutionellen Kern der `Zivilgesellschaft' bilden nicht-staatliche und nicht-ökonomische Zusammenschlüsse auf freiwilliger Basis, die, um nur unsystematisch einige Beispiele zu nennen, von Kirchen, kulturellen Vereinigungen und Akademien über unabhängige Medien, Sport- und Freizeitvereine, Debattierclubs, Bürgerforen und Bürgerinitiativen bis zu Berufsverbänden, politischen Parteien, Gewerkschaften und alternativen Einrichtungen reichen" (Jürgen Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Vorwort zur Neuausgabe 1990, Frankfurt a.M. 1990, S. 46).
"Die Zivilgesellschaft ist eine Sphäre sozialer Institutionen und Organisationen, die nicht direkt der Funktion politischer Selbstverwaltung integriert sind und nicht unmittelbar staatlicher Regulierung unterliegen, doch in verschiedener Weise auf den Staat einwirken: für ihn Grundlagen bereitstellen, Rahmenbedingungen setzen, seine Leistungen ergänzen, ihn aktiv beeinflussen. In Wirtschaft, Kultur, Bildung, Medien, Verbänden usw. erfüllt die Zivilgesellschaft Funktionen, die sich nicht in der Koordinierung von Privatinteressen erschöpfen, sondern die Konstitution eines Allgemeinen tragen. Sie bildet kollektive Identität(en), begründet Gemeinsinn, stiftet Öffentlichkeit, fördert soziale Sicherheit" (Emil Angehrn: Zivilgesellschaft und Staat. Anmerkungen zu einer Diskussion, in: Jahrbuch Politisches Denken 1992, S. 145-157).
"Civil society is just such a projection of our desires. Worse, it gravely misdescribes the world we actually confront. As a concept it has almost no specific gravity. It is little better than a Rorschach blot...
The idea of civil society simply coincides with the tropism toward privatization that has been the hallmark of these post-cold war times. Far from being oppositional, it is perfectly in tune with the Zeitgeist of an age that has seen the growth of what proponents like Bill Clinton and Tony Blair are pleased to call the "Third Way" and what might unsentimentally be called "Thatcherism with a human face". As we privatize prisons, have privatized development assistance and are in the process, it seems, of privatizing military interventions into places likeNew Guinea, Sierra Leone and Angola by armies raised by companies like Sandline and Executive Outcomes, so let us privatize democracy-building ....The fact that all this comes couched in the language of emancipation does not, in and of itself, make it emancipatory. Indeed, there are times when it seems as if the advocats of civil society are the useful idiots of globalization". David Rieff, The False Dawn of Civil Society, in: The Nation, 22.2.1999
