Heft 69: Soziale Politiken International
![]() 1998 |
Inhalt
| Editorial
| Leseprobe
1998 |
Inhalt
| Editorial
| Leseprobe
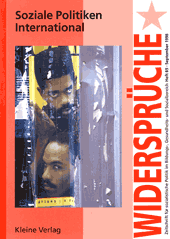
- September 1998
- 116 Seiten
- EUR 11,00 / SFr 19,80
- ISBN 3-89370-288-1
Steve Burghardt, Michael B. Fabricant
Bedingungen für die Entwicklung einer gemeinwesenorientierten Praxis der Sozialen Arbeit
Mit dem Erstarken der Rechten in den Vereinigten Staaten und in Europa richten sich Reformbemühungen nicht mehr in erster Linie auf die staatlichen Institutionen, sondern auf diejenigen des sogenannten "Freien Marktes" (Aronowitz 1996). Das wird von konservativer Seite mit dem Argument begründet, der Wohlfahrtsstaat, seine Professionellen und seine politischen Köpfe hätten keine funktionierenden Antworten mehr auf die Verschlechterung der Lebensbedingungen der Armen und die nachlassende Qualität der Lebensbedingungen in den lokalen Gemeinschaften. In diesem Beitrag wird jedoch weder erneut der Grad dieser Verschlechterung dokumentiert (Wilson 1996) noch die bürokratischen Routinen des "Mehr desselben" der sozialen Interventionen (Fabricant/Burghardt 1992; Dressel 1992); vielmehr werden wir Vorschläge entwickeln, wie die derzeitige Praxis im Umgang mit den Armen geändert werden kann.
Wir gehen in unserem Papier davon aus, daß es den nichtstaatlichen und den Non Profit-Organisationen nicht gelungen ist, ein Bewußtsein für das Gemeinwesen und für die Mitgliedschaft in ihren Einrichtungen aufzubauen. Sie tragen eher zu der Erosion eines aktiven bürgerschaftlichen Engagements bei, als daß sie es befördern. Wir unterstellen, daß bürgerschaftliches Engagement nicht aus sich selbst heraus entsteht, sondern daß ihm von allen staatlichen Wohlfahrtseinrichtungen Nahrung und Unterstützung zukommen muß. Gerade angesichts des derzeitigen Verfalls der Gemeinschaften kommt jedem Kontakt zwischen einem Klienten und einer Wohlfahrtseinrichtung die Qualität zu, das Bewußtsein für demokratische bürgerschaftliche Teilhabe entweder zu befördern oder zu verschlechtern. Deshalb werden wir hier auf zwei fundamentale Aspekte einer gemeinwesenorientierten Praxis hinweisen: Wir beschreiben zunächst die Erfahrungen, die ein Klient schrittweise macht, wenn er in Kontakt mit einem Sozialen Dienst kommt und ihn durchläuft. Diese Erfahrungen gilt es zu verbessern und effektiv zu nutzen. Zweitens beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Regeln etabliert werden müssen, um das Interesse der Klienten an einer aktiven Mitgliedschaft in den entsprechenden Einrichtungen zu wecken.
Die Sackgasse der Sozialen Dienste: Der Zerfall der Gemeinschaften und der Rückzug der Klienten
Die Standardliteratur zu den Sozialen Diensten ist von Texten dominiert, die die Menschen eingebettet in ihre Umgebung betrachten (Meyer & Medderratti 1997). Auf dieser Basis werden Modelle für professionelle Interventionen auf der Mikro-, der Meso- und der Makro- Ebene entwickelt, die sich zum Teil überlappen. In vielen Variationen konzipieren diese Modelle das Verhältnis zwischen den Sozialen Diensten und der lokalen Gemeinschaft. Sie gehen jedoch alle von einer Beziehungsdichte zwischen den Sozialen Diensten und der jeweiligen Gemeinschaft aus, die es angesichts der heutigen Lebenslagen schon lange nicht mehr gibt. So haben zum Beispiel Putnam (1993) und Schorr (1997) die verschiedenen Faktoren dokumentiert, die die Bürger daran hindern, sich am öffentlichen Leben zu beteiligen. Überarbeitete Mittelschichtsangehörige, die nicht mehr in der Nähe ihrer Arbeitsstätte leben und sich unter dem Druck des Arbeitsmarktes 'flexibilisierten' Arbeitszeiten anpassen, sich um die Versorgung ihrer Kinder kümmern und ökonomischen Verpflichtungen nachkommen müssen, ohne dabei auf Familien-Unterstützung zurückgreifen zu können, sind weniger in bürgerschaftliche Aktivitäten eingebunden, als dies jemals in den vergangenen fünfzig Jahren der Fall gewesen ist.
Von größter Bedeutung für die Organisationen des Wohlfahrtsstaates ist die Analyse von W.J. Wilson. In seinen Arbeiten The Truly Disadvantaged und When Work Disappears hat er die Zusammenhänge zwischen sozioökonomischen Trends und demographischen Veränderungen dokumentiert, die schließlich zum Zusammenbruch vieler Gemeinschaften geführt haben. Er hat gezeigt, daß in den armen Gemeinden durch die Tendenz der Industrie, sich in den Vorstädten anzusiedeln oder im Ausland zu investieren, die Arbeitsplätze weggebrochen sind und daß das gerade die Mittel- und die Arbeiterklasse - und hier besonders diejenigen, die im öffentlichen Dienst standen - dazu veranlaßt hat, in bessergestellte Stadtteile umzuziehen. Die Konsequenzen für die Gemeinwesenstrukturen waren dramatisch und komplex, da das institutionalisierte Leben in den Gemeinwesen besonders durch die Mittelklasse höchst effektiv unterstützt worden war. Ihre Erfahrungen, ihre Sozialisation, ihre Werte und ihre ökonomische Stärke hatten es diesen Bewohnern ermöglicht, den Alltag zu strukturieren, die ökonomischen Mittel aufzubringen und eine Anwesenheitsdichte zu schaffen, die als entscheidende Zutaten für ein starkes Gemeinwesen betrachtet werden müssen. Dagegen hatten die in den benachteiligten Gemeinwesen zurückgebliebenen Armen nicht die Erfahrungen und die Kapazitäten, um die Leerstellen zu füllen, die mit der Migration der Mittelklasse entstanden sind. Zusätzlich führte der Verlust von Arbeitsplätzen in Verbindung mit dem Verschwinden von sozialen Netzwerken, die auch über die benachteiligten Quartiere hinwegreichten, zu einer wachsenden sozialen, ökonomischen und politischen Isolation dieser Quartiere. Wilson hat darauf hingewiesen, daß die Zunahme von ungesetzlicher Arbeit (etwa Drogenhandel), von Desinteresse an Ausbildung oder von Schwangerschaften Minderjähriger großteils mit der Transformation und zunehmenden Isolation dieser Stadtteile zusammenhing. Wilsons Analyse läßt daher den Schluß zu, daß wirtschaftlich verwundbare und in ihrem sozialen Leben marginalisierte Menschen weder die Möglichkeit noch das Interesse haben, sich am sozialen Leben der quartiersbezogenen Einrichtungen zu beteiligen.
Die zukünftige Stärke dieser Gemeinschaften wird davon abhängen, ob es gelingt, Verbindungen zwischen den staatlichen Sozialen Diensten und den Bewohnern zu schaffen. Doch so, wie diese Dienste derzeit arbeiten, laden sie häufig nicht zu einer aktiven Teilnahme der Bewohner ein, sondern verstärken eher deren Mißtrauen und Isolation. Staatliche Einrichtungen Sozialer Arbeit, etwa Ausbildungsprogramme, Kliniken, Kindertagesstätten oder Projekte zur Gemeinwesenentwicklung sind ohne Frage in den vergangenen Jahren von Mittelkürzungen betroffen. Dies hat ihre Arbeit und ihre Verfügbarkeit für ihre Nutzer nachteilig beeinflußt. Zugleich hat die Finanzkrise aber auch die darunter verborgene und lang andauernde Krise des Verhältnisses zwischen den Sozialen Diensten und den Bürgern hervortreten lassen. Die Bürokratie des Wohlfahrtsstaates hat die Menschen eher zu passiven Nachfragern individueller Hilfe gemacht. Daß der Staat die Verteilung der knappen finanziellen Ressourcen mit wachsender Strenge überwacht, verstärkt diese Tendenz.
Und so haben gerade die Errungenschaften, mit denen eine Verstärkung der Bürgerrechte erreicht werden konnte (etwa die Arbeitslosenversicherung oder die Gesundheitsversorgung), zu einer Verringerung bürgerschaftlicher Aktivitäten geführt (Barbalet 1988; Moon 1988, 1993). Außerdem sollen die staatlichen Institutionen nun Dienste anbieten, deren Erbringung früher in der Verantwortung der Gemeinschaften selbst gelegen hat: etwa die Sorge für kleine Kinder, für die Alten oder für ausreichende Arbeit. Die Organisationen, von denen Unterstützung verlangt wird, haben selten bedacht, daß die Qualität ihrer Arbeit in einem engen Zusammenhang mit dem Vorhandensein funktionierender Verbindungen zu den Gemeinwesen steht.
Soziale Dienste und die Entwicklung einer gemeinwesenorientierten Praxis
Andererseits kann die tägliche Arbeit der Sozialen Dienste durchaus eine zureichende Ausgangsbasis für Vertrauen und Verbindung bieten, da sie darauf ausgerichtet ist, die drückendsten Sorgen Einzelner zu lindern. Zudem werden viele Soziale Dienste mit bestimmten Orten verbunden und sind damit durchaus für Mitgliedschaft geeignet. Vor allem in den folgenden Bereichen haben sich Soziale Dienste häufig erfolgreich dadurch hervorgetan, daß sie der Entstehung bzw. Ermöglichung von Mitgliedschaftsbeziehungen besonderen Wert beigemessen haben: Wohngruppen für körperlich Behinderte, Drogenprogramme, gemeinwesenorientierte Arbeit mit geistig Behinderten, kooperative Ansätze im Schulwesen, lokale Umweltschutzinitiativen (Lieberman et al. 1991; Child Development Project 1994; Bondy et al. 1994; Swartz 1995; Sergiovanni 1994; Comer 1980; Medoff/Sklar 1994; Fairweather et al. 1969; Kretzman/McKnight 1993; O'Connell 1988, 1990; International Association... 1992; Crewe/Zola 1983; Walsh 1996; Burghardt/Fabricant 1987; Fabricant/Smith 1998; Stone 1996; Boyte 1996). Diese Experimente teilen verschiedene Merkmale. Erstens bedarf es einer Anleitung, die Verbindung zwischen den Quartiersbewohnern und dem Sozialen Dienst zu initiieren, zu implementieren und auf Dauer zu stellen. Zweitens müssen die Organisationen zulassen, daß ihre Benutzer ihre kulturellen Vorstellungen und Zweckbestimmungen einbringen. Drittens sind sie (mit Ausnahme der Schule) nicht im öffentlichen Dienst angesiedelt; es handelt sich um Freie Träger. Viertens sind die meisten Einrichtungen klein und beschränken ihre Arbeit auf ausgewählte Gebiete. Von ihnen können wir lernen, wie es gelingen kann, Zugehörigkeitsgefühle herzustellen.
Die verschiedenen Stufen des Aufbaus einer Gemeinwesenorientierung
Der erste Schritt besteht darin, den interessierten Menschen Gelegenheit zum Engagement zu geben. Dies ist der entscheidende Schritt, denn aus vielerlei Gründen gehen die Bewohner eher argwöhnisch und mechanisch auf die Einrichtungen zu. Nicht eingehaltene Verabredungen, nur dünn besuchte Versammlungen und distanzierte oder instrumentelle Beziehungen zu den Mitarbeitern drücken dies aus. So schreibt Berman-Rossi (1995):
"Von Beginn an lief alles auf einen Eklat zwischen dem Mitarbeiterteam und den Bewohnerinnen hinaus. Das Team betonte die Rechte der Bewohnerinnen, Dienstleistungen in Empfang zu nehmen; die Bewohnerinnen betonten ihr Recht, diese Dienstleistungen abzulehnen. Das Team war der Ansicht, die Bedürfnisse der Bewohnerinnen zu kennen; die Bewohnerinnen glaubten selbst darüber Bescheid zu wissen. Das Team hielt gegenseitige Hilfe für die entscheidende Bedingung ihres kollektiven Lebens; die Bewohnerinnen setzten dagegen auf Unabhängigkeit und Individualität. Die vom Team erwarteten interdependenten Beziehungen wurden von den Bewohnerinnen als Bedrohung empfunden. (...) Die Haltung der Mieterinnen wurde durch ihre vorangegangenen enttäuschenden Erfahrungen und durch ihre Einschätzung genährt, es gebe keinen Grund, warum gerade diese Professionellen sich von den vorhergehenden unterscheiden sollten. Beide Seiten verhielten sich ausgesprochen vorsichtig."
Bereits gemachte nachbarschaftliche Erfahrungen können den Eindruck erzeugt haben, daß gemeinsames Handeln das Spektrum der Möglichkeiten nicht erweitern, sondern im Gegenteil einschränken (Wagner 1993). Sie können die Betroffenen dazu bringen, sich emotional zurückzuziehen und von gemeinsamen Aktionen fernzuhalten. In solchen Lebenszusammenhängen haben die nachfolgenden Generationen schrittweise immer weniger Interesse daran, kollektiv zu handeln. Dabei ist es so entscheidend wie schwierig, die Bürger in Aktivitäten zum Aufbau des Gemeinwesens einzubeziehen. Aber die Partizipation ist am sinnvollsten erst im zweiten Stadium des Prozesses angesiedelt. Vor dem Hintergrund des verständlichen Mißtrauens der Nutzer ist es zunächst erforderlich, ein Umdenken hinsichtlich ihres Verhältnisses zu dem Sozialen Dienst zu erreichen. Von Beginn des ersten Kontakts mit dem Dienst oder mit seinen Aktivitäten vor Ort an müssen Gelegenheiten gefunden werden, die die Verbundenheit befördern. Zum Beispiel muß von Seiten des Sozialen Dienstes überlegt werden, wie die Bewohner eingeladen oder willkommen geheißen werden können, an seinen Aufgaben und Angeboten teilzunehmen.
Der zweite Schritt zum Aufbau funktionierender Gemeinwesen ist der Übergang von einem bloßen Nutzer der Dienstleistung zu einem aktiv Teilnehmenden. Teilnahme heißt, ihm einen Anteil an der institutionellen Macht zuzugestehen und im besten Fall Gleichheit zwischen ihm und dem Personal herzustellen. Vertiefte Formen der Identifikation werden nämlich kaum eintreten, wenn den Nutzern lediglich restriktive oder symbolische Anteile an den Entscheidungsprozessen des Sozialen Dienstes zugebilligt werden. Eine Organisation kann daher nur als gemeinwesenorientiert bezeichnet werden, wenn sie auf einer entsprechend demokratischen Kultur beruht. Demokratie bedeutet dabei weit mehr als die Etablierung von Verfahren, die der Berücksichtigung von Wünschen und Anregungen aus dem Gemeinwesen dienen; vielmehr müssen Wege gefunden werden, die Teilhabemöglichkeiten der Quartiersbewohner systematisch zu verbreitern (Moon 1993; Barbalet 1988). So entsteht allerdings die anspruchsvolle Erwartung, daß die Bewohner sich aus eigener Initiative in die ständig verbreiternden Netzwerke der Sozialen Dienste einschalten werden. Die Häufigkeit der Aktivitäten der Benutzer im Rahmen des Sozialen Dienstes ist jedoch nur ein Indikator für quantitative Partizipation; die Qualität der Partizipation, die eher an der Intensität der Benutzeraktivitäten abgelesen werden kann, ist viel entscheidender dafür, ob es gelingt, Beziehungen zu entwickeln, die zu vertieften, d.h. Mitgliedschaftsverhältnissen zwischen dem Sozialen Dienst und den Bewohnern reifen können.
Viele Bewohner werden niemals von individuellen zu kollektiven Beteiligungsformen übergehen, indem sie Angebote bspw. nur aufsuchen, um sie für ihre familiären Interessen zu funktionalisieren und individuelle Probleme zu lösen, ohne ein Verhältnis zur Gruppe zu entwickeln, geschweige denn zu internalisieren. Für die aktive Teilhabe ist es daher entscheidend, interdependente Beziehungsformen mit anderen Teilnehmern zu aufzubauen. Solche Formen können aber nur verwirklicht werden, wenn sie bewußt in die Struktur und die Inhalte der Aktivitäten des Sozialen Dienstes eingebaut werden.
Die kürzlichen Reformen in den Sozialen Diensten haben die Stärkung der individuellen Unabhängigkeit ihrer Klienten betont und wenig, wenn nicht gar keine Aufmerksamkeit darauf verwandt, die Interdependenzen zwischen den Individuen zu unterstreichen. Individuelle Unabhängigkeit als primäres Ziel verstärkt Prozesse der Vereinzelung. Zum Beispiel kann ein geistig Behinderter, mit dem auf individuelle Unabhängigkeit hingearbeitet wird, in einem Ein-Zimmer-Appartement und an einem isolierten und entfremdeten Arbeitsplatz enden. Daher muß beim Aufbau einer gemeinwesenorientierten Perspektive ein Bewußtsein für die Interdependenzen zwischen den Teilhabenden geschaffen werden. Die Wahrnehmung einer echten Verbindung zwischen Kollektiv und Individuum bildet die Voraussetzung dafür, daß der Einzelne sich als Mitglied des Gemeinwesens versteht. Dies ist auch für die Qualität jedes individuellen Lebens von großer Bedeutung. Das verinnerlichte Wissen um Interdependenz ist die Basis, auf der reziproke Kooperation, Vertrauen - und letztlich Gemeinschaft - aufgebaut sind.
Die dritte Stufe der Teilhabe ist Mitgliedschaft. Wie bereits erwähnt, bedarf Mitgliedschaft einer weitergehenden Identifikation mit kollektiver Erfahrung. Der Einzelne investiert emotional sowohl in die anderen Personen als auch in die Zwecke der Organisation. Teilweise bringt er seine individuellen Ziele, seine Bedürfnisse und seine Identität mit der Sozialen Organisation in Einklang. Diese Stufe der Teilhabe ist zum Teil durch Aktivitäten gekennzeichnet, die in erster Linie der Gruppe und nicht nur dem Einzelnen dienen. Eine solche Art der Investition unterscheidet sich von den Austauschbeziehungen des Marktes dadurch, daß die Aufwendungen für die Gruppe als individuelle Bereicherung erfahren werden, wie zum Beispiel im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, wo der Verzicht von den Eltern als Gewinn erfahren wird, weil er zu einer vertieften Identifikation mit der Familie als Ganzes führt.
Doch wie gelingt es, Einzelne von einem hochindividualisierten zu einem komplexeren, kollektiven Verständnis von Austausch und Gewinn zu führen? Dafür muß ein Sinn für geteilte oder kollektive Zwecke entwickelt werden, welcher notwendigerweise in Beziehungen wurzelt, die Reziprozität, Kooperation, Vertrauen, affektive Bindungen und historische Kontinuität gewährleisten. Der Soziale Dienst kann die Entstehung solcher Beziehungen über besondere Ereignisse wie etwa Feste fördern, womit sich nicht nur der Respekt des Sozialen Dienstes vor der Gemeinschaft ausdrückt, sondern gleichzeitig den Nutzern auch die Chance gegeben wird, ein Bewußtsein für ihre Kompetenz und Teilhabechancen zu entwickeln. Es ist eine schwierige Aufgabe, solche demokratisierten Verkehrsformen zu gestalten und aufrechtzuerhalten, da diese einer ständig aktualisierten Demokratisierung des Sozialen Dienstes bedürfen. Die spezifischen Regeln zum Aufbau einer gemeinwesenorientierten Praxis werden im folgenden diskutiert.
Der letzte Schritt zum Aufbau einer gemeinwesenorientierten Praxis erfordert, daß die Erfahrungen innerhalb der einzelnen Sozialen Dienste in die Gemeinschaft als Ganzes hineingetragen werden. Damit wird angestrebt, daß die verschiedenen Sozialen Dienste gemeinsam handlungsfähig sind. Auf diese Weise kann die politische Kraft der Gemeinschaft erweitert und in Verhandlungen über eine Umverteilung der Ressourcen eingesetzt werden.
Organisatorische und praktische Regeln für den Aufbau einer gemeinwesenorientierten Praxis
Die skizzierten Schritte erfordern eine Kultur und einen Führungsstil, der den Sozialen Dienst in die Gemeinschaft eingebettet sieht und zudem bereit ist, die knappen Ressourcen zum Nutzen aller zu teilen. Hierdurch entstehen mehrere Dilemmata, denn die jeweiligen Sozialen Dienste werden von Geldgebern und Staat grundsätzlich daran gemessen, was sie hinsichtlich ihrer individuellen Aufgaben zu leisten imstande sind. Zudem bringt die angestrebte Zusammenarbeit Einzelpersonen und Soziale Dienste zusammen, die schon lange im Konflikt miteinander stehen sowie unter unterschiedlichen fachlichen und politischen Schwerpunkten arbeiten. Daher sind eine Reihe von organisatorischen und praktischen Regeln erforderlich, um eine dem ganzen Gemeinwesen dienende Soziale Arbeit entwickeln zu können. Dabei ist erneut die bereits aufgeworfene Frage zu bedenken: Wie entwickeln sich die Stadtteilbewohner zu Mitgliedern in den Sozialen Diensten? Die Praktiker müssen bei der Schlüsselstellung der Emotionen im Verhältnis Klient - Professioneller beginnen. Wenn es zu der Herausbildung eines verantwortlichen Gefühls für das Gemeinwesen kommen soll, muß dieses Verhältnis in die Handlungen und Regeln ihrer Arbeit einfließen. Dabei stehen die auf Emotionen aufruhenden professionellen Verhältnisse deutlich in einem Spannungsverhältnis zu den professionellen Praktiken, bei denen objektive Distanz, methodische Intervention und spezifisches Fachwissen im Vordergrund stehen.
Gleichwohl ist es für den Aufbau einer gemeinwesenorientierten Praxis unabdingbar, den subjektiven und emotionalen Kontext der Beziehungen zu nähren. Beziehungen zwischen Sozialem Dienst und Bewohnern müssen auf Erfahrungen bzw. Normen von Reziprozität aufgebaut sein: Es kann nicht erwartet werden, daß Geben unmittelbar oder direkt korrespondierend beantwortet wird. Geben soll vielmehr umfassend vergleichbare gebende Haltungen stimulieren. Ein Geist der Generosität und Spontaneität sowie das Fehlen reiner Kalkulation ist zumindest ein Schritt auf dem Weg zum Aufbau von Vertrauen und Kooperation. Ab einem bestimmten Punkt kann Reziprozität die kalkulierende Bedeutung von Geben und Nehmen aufheben. So mag etwa die Bemühung einer mißhandelten Frau, andere Frauen an die Lebensbedingungen in ihrer Einrichtung zu gewöhnen, nicht unbedingt zu einer Arbeitsentlastung der Professionellen führen, aber ihre Anstrengungen sind eine Gabe und ein Ausdruck von Reziprozität. Nur in einem so erweiterten Zusammenhang kann es gelingen, auf der Basis gemeinsamer Verantwortung Vertrauen und gegenseitiges Verständnis aufzubauen (Freire 1972; Burghardt 1982).
Grundlage reziproker Verhältnisse ist ein gewisser Grad an gleichwertiger Verteilung der Macht:
"Ein vertikales Netzwerk, egal, wie dicht, und egal, wie wichtig es für seine Mitglieder ist, kann Vertrauen und Kooperation allein nicht gewährleisten. Die Beziehungen zwischen den Professionellen und den Klienten beinhalten immer interpersonale und reziproke Verpflichtungen. Doch im traditionellen Berufsalltag sind die Beziehungen vertikal und die Verpflichtungen asymmetrisch. Klientelismus kommt vor Freundschaft. Es entsteht keine Möglichkeit, Regeln generalisierter Reziprozität und gegenseitiger Verpflichtung zu entwickeln, auf die dann gebaut werden kann" (Putnam 1993).
Netzwerke größerer Spannweite und Gleichheit sind dagegen horizontal geknüpft. Nur solche Netzwerken können zu kollektiven Aktionen beitragen und die Bindungen in den Gemeinwesen stärken. Wie Harry Boyte (1996) dazu bemerkt hat, müssen sich die Professionellen und die Bewohner als kooperierende Produzenten innerhalb des Sozialen Dienstes erfahren und akzeptieren.
Deborah Meier, die innovative Leiterin der Central Park East School im New Yorker Stadtteil East Harlem beschreibt, wie ein solcher Prozeß den Professionellen dazu verhelfen kann, ihre Arbeit in diesen Zusammenhang zu stellen:
"Central Park East School hat ein Lernumfeld entwickelt, in dem alle Beteiligten als Ko-Produzenten der Ausbildung verstanden werden. Studenten, Eltern, Stadtteilbewohnern und unterstützenden Mitarbeitern kommen neben den Lehren wichtige Rollen zu. Mehr noch: in der Schule herrscht ein gut entwickeltes Verständnis dafür, daß die Investitionen in das Gemeinwesen die Brücke bilden, um die ansonsten scharf voneinander getrennten Bereiche zusammenzuführen" (nach Boyte 1996).
Entscheidend ist also das Zusammenwirken der Demokratisierung der Sozialen Dienste, der Entwicklung horizontaler Netzwerke und des Aufbaus kommunaler Beziehungen. Vor allem die horizontalen Netzwerke demystifizieren die Arbeit der Sozialen Dienste. Diese Demystifizierung führt zu informelleren und daher leichter zugänglichen Diensten. Auch hier gilt, daß die Umverteilung der Macht und die Neudefinition der Beziehungen mit potentiellen Konflikten belastet ist, weil Spannungen zwischen den traditionellen und dem gemeinwesenorientierten Praxen der Professionellen ohne Frage weiter bestehen werden.
Eine weitere entscheidende Norm auf dem Weg zu einer gemeinwesenorientierten Praxis ist die Erwartung individueller Verantwortung und Zurechenbarkeit. Denn auch wenn die besten Absichten bestehen: Solange keine Regeln existieren, wie die Mitarbeiter und die Bewohner ihrer Verantwortung nachzukommen haben, wird jeder Versuch zum Aufbau angemessener Beziehungen mit großer Wahrscheinlichkeit fehlschlagen. In der Vergangenheit sind fortschrittliche Kräfte zu oft davon ausgegangen, daß geteilte Verantwortung gleichsam organisch aus gutem Willen und guten Absichten entsteht. Doch wie Paulo Freie (1972) deutlich gemacht hat, sind solche Annahmen nur Schein. Jede Leitung eines sozialen Dienstes, die sich dem Aufbau gemeinwesenorientierter Strukturen verschrieben hat, muß ihre Aufmerksamkeit auf die Entwicklung und Verstärkung von Verantwortlichkeitsstrukturen richten.
Solche Gefüge können im Widerspruch zu der Notwendigkeit stehen, Entscheidungsstrukturen zunehmend gleichberechtigt statt hierarchisch zu gestalten. Darum muß die Frage aufgeworfen werden, wie innerhalb horizontaler Beziehungen Verantwortlichkeit erreicht werden kann. Wir gehen davon aus, daß demokratisch verwaltete Gruppen sehr wohl spezifische Regeln der Verantwortlichkeit und Zurechenbarkeit entwickeln können. So können zum Beispiel Arbeitsaufgaben, die geistig Behinderten obliegen, wie etwa das Führen eines Cafés, die Reinigung bestimmter Räume oder die Verwaltung einfacher Daten, von der ganzen Gruppe verteilt und überwacht werden. Die Sanktionen für den Fall, daß einzelne Arbeitsaufgaben nicht erfüllt werden, können ebenfalls von allen Beteiligten gemeinsam erarbeitet werden. Das ist zwar aller Voraussicht nach weniger effektiv als die Festlegung durch einen einzelnen verantwortlichen Geschäftsführer, aber die Zeitverluste werden durch das kollektive und individuelle Gefühl aktiver Teilhabe an der spezifischen Verantwortung mehr als ausgeglichen: Die Entwicklung von einschlägigen Regeln durch die ganze Gruppe wird zu deren Internalisierung führen - und zwar häufig sogar einer weitergehenden als bei den Professionellen selbst. Allerdings kann die Fähigkeit einer Gruppe, sich mit anstehenden Aufgaben zu befassen und diese zu lösen, eingeschränkt sein, zum Beispiel in Krisensituationen. Entsprechend können einzelnen Entscheidungsbefugnisse zugestanden werden, damit angemessen und schnell reagiert werden kann. Die betreffenden Personen müssen jedoch der Gruppe rechenschaftspflichtig bleiben. Es muß also eine strukturelle Balance geschaffen und gehalten werden zwischen der Gleichberechtigung der Gruppenmitglieder in der Entscheidungsfindung und der Wertschätzung von bzw. dem Vertrauen in einzelne, die als Entscheidungsträger für die ganze Gruppe handeln, wenn ihnen die Verantwortung für bestimmte Aufgaben übertragen wird.
Eine weitere, auf allen Stufen der Entwicklung einer gemeinwesenorientierten Arbeit gleichermaßen wichtige Norm ist gegenseitiger Respekt, vor allem der Respekt hinsichtlich sozialer Unterschiedlichkeit. Für diese Norm sollte die Unterscheidung zwischen Toleranz und Anerkennung leitend sein. Die Tolerierung von Differenz(en) ist zunächst die notwendige Grundvoraussetzung jedes demokratischen Gemeinwesens. Bloß tolerierender Respekt kann aber auch als eine Art vorsichtiger Wachsamkeit interpretiert werden: Die Form ist dann zwar gewahrt, aber der respektierende Anteil an der jeweiligen Handlung ist kaum wahrzunehmen. Respektvolle Anerkennung dagegen ist weit mehr. Sie versteht Differenz als Herz und Atem jeder Gemeinschaft; ohne Differenz scheint ihr die Gemeinschaft mechanisch und leblos.
Schließlich ist die umfassende Beteiligung aller Mitglieder des Gemeinwesens der unverzichtbare Rahmen jeder gemeinwesenorientierten Arbeit. Zwar sind bestimmte Soziale Dienste auf spezifische Dienstleistungen festgelegt und etwa vertraglich verpflichtet, ihre Angebote geistig Behinderten, Alten oder Kindern und Jugendlichen vorzubehalten. Doch selbst diese zielgruppenorientierten Dienste können Angebote entwickeln, die auch andere Gruppen aus ihrer lokalen Gemeinschaft einbeziehen. So können etwa junge Leute dafür gewonnen werden, Alte zu betreuen, oder Eltern dafür, als Tutoren an Schulen zu wirken. Geschieht dies nicht, so wird der jeweilige Soziale Dienst in seinem Verhältnis zu seiner unmittelbaren räumlichen Umgebung auf lange Sicht marginalisiert. Er wird dann als eine Organisation angesehen, die zwar bestimmten Personen einen bedeutenden Service anbietet, aber zu den kommunalen Netzwerken keinen nennenswerten Beitrag leisten kann.
Es ist deutlich, daß bei dem Aufbau einer gemeinwesenorientierten Sozialen Arbeit noch eine ganze Reihe von weiteren Elementen berücksichtigt werden müssen. Wir denken dabei vor allem an spezifische Instrumente zur stetigen Anpassung der Organisationsstrukturen, mit denen die von uns genannten Regeln verläßlich gemacht und auf Dauer gestellt werden können, an die Bedeutung von Kunst und Kultur oder an Mittel, mit denen die physische Präsenz der jeweiligen Einrichtung verdichtet werden kann. Wir sind jedoch der Ansicht, daß die Sozialen Dienste entlang der von uns skizzierten erforderlichen Prozesse und der daraus abgeleiteten Regeln beginnen könnten, kommunale Erfahrungen zu sammeln. Diese Praxis kann zur Wiederbelebung und Erholung eines kollektiven demokratischen Charakters beitragen, der das Herzstück der progressiven Agenda bildet und energisch gegen den Konservatismus und dessen Betonung der individualisierten Rechte auf dem sogenannten Freien Markt steht.
Literatur
Aronowitz, Stanley 1996: Winning and Losing in a Conservative Age. In: Social Policy 1
Barbalet, J.M. 1988: Theories of Citizenship. University of Minnesota Press, Minneapolis
Berman-Rossi, Toby 1995: Empowering Groups through Understanding of Group Development. In: Social Work with Groups, Spring
Bondy, Elizabeth; Kilgore, Karen; Ross, Dorene; Webb, Rodman 1994: Building Blocks and Stumbling Blocks: Three Case Studies of Shared Decision Making and School Restructuring. NCREST, New York
Boyte, Harry 1996: Building America: The Democratic Promise of Public Work. Temple University Press, Philadelphia
Burghardt, Steve 1982: The Other Side of Organizing. Schenkman Publishing, Boston
Burghardt, Steve; Fabricant, Michael 1987: Working under the Safety Net: Policy and Practice with the New American Poor. Sage Publications, Newbury Park/CA
Child Development Project 1994: A Guide to Activities that Build Community: At Home in Our Schools. Developmental Studies Center, Oakland/CA
Comer, James 1980: School Power. Free Press, New York
Crewe, Nancy; Zola, Irving 1983: Independent Living for Physically Disabled People. Jossey Bass, San Francisco
Dressel, Paula 1992: Why Build More Prisons? A Political Economic Interpretation. In: Journal of Sociology and Social Welfare 3
Fabricant, Michael Burghardt, Steve 1992: The Crisis of the Welfare State and the Transformation of Social Service Work. M.E.Sharpe, Armonk/NY
Fabricant, Michael; Smith, Michael 1998: A Case Example of Agency Based Community Building with the Mentally Ill. Unpublished Paper, Hunter College School of Social Work, New York
Fairweather, George; Sanders, David; Cressler, David; Maynard, Hugo 1969: Community Life for the Mentally Disabled: An Alternative to Institutional Care. Aldine, Chicago
Freire, Paulo 1972: Pedagogy of the Oppressed. 1994, New York
International Association for Psychosocial Rehabilitation Services 1992: Psychosocial Rehabilitation Journal 2
Kretzman, John; McKnight, John 1993: Building Communities from the Inside Out. ACA Publications, Chicago
Lieberman, Ann; Hammond, Linda Darling; Zuckerman, David 1991: Early Lessons in Restructuring Schools. NCREST, New York
Medoff, Peter; Sklar, Holly 1994: Streets of Hope: The Fall and Rise of an Urban Neighborhood. South End Press, Boston
Moon, J. Donald 1988: The Moral Basis of the Welfare State". In: Amy Gutman (ed.): Democracy and the Welfare State. Princeton University Press, Princeton/NJ
Moon, J. Donald 1993: Social Citizenship and Welfare: Social Democratic and Liberal Perspectives. In: W.J. Wilson (ed.): Sociology and the Public Agenda. Sage Publications, Newbury Park/CA
O'Connell, Mary 1988: The Gift of Hospitality: Opening the Doors of Community Life to People with Disabilities. Center for Urban Affairs and Policy Research: Northwestern University, Chicago
O'Connell, Mary 1990: Community Building in Logan Square: How a Community Grew Stronger with the Contributions of People with Disabilities. Center for Urban Affairs and Policy Research: Northwestern University, Chicago
Putnam, Robert 1993: The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. In: The American Prospect, Spring
Sergiovanni, Thomas 1994: Building Communities in Schools. Jossey Bass, San Francisco
Schorr, Lisbeth 1997: Common Purpose: Strengthening Families and Neighborhoods to Rebuild America. Anchor, New York
Swartz, Sue 1995: Community and Risk in Social Service Work. In: Journal of Progressive Human Services 1
Stone, Rebecca 1996: Core Issues in Comprehensive Community Building Initiatives. Chapin Hall Center for Children, Chicago
Wagner, David 1993: Checkerboard Square: Culture and Resistance in a Homeless Community. Westview Press, Boulder/CO
Walsh, Joan 1996: Stories of Renewal: Community Building and the Future of Urban America. Rockefeller Foundation, New York
Wilson, W.J. 1987: The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Under Class, and Public Policy. University of Chicago Press, Chicago
Der Beitrag wurde übersetzt von Michael Lindenberg
