Heft 37: Verlust und Befreiung - Nach dem Umbruch im Osten
![]() 1990 |
Inhalt
| Editorial
| Leseprobe
1990 |
Inhalt
| Editorial
| Leseprobe
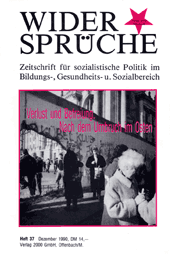
- Dezember 1990
- 100 Seiten
- EUR 7,00 / SFr 13,10
- ISBN 3-88534-055-0
Schwierige Abschiede
Fragmente zu den Erfahrungen der Jahre 1989/90
"Auf Befreiung folgt Verlust"
"Befreiung" anläßlich der rasanten Geschehnisse in der DDR seit dem Herbst 1989 empfinde ich zunächst und uneingeschränkt, indem ich voller Spannung den dortigen Prozeß der Herstellung und Aneignung von Öffentlichkeit verfolge. 1985 hatte ich im Anschluß an eine Reise der Widersprüche-Redaktion nach Leipzig meine Eindrücke und Erfahrungen in einer Geschichte, die vom Aufstieg und Fall bzw. Gefällt-Werden einer Fraueninitiative handelt, verarbeit: Bis heute nachhaltig beeindruckt hat mich das systematische Ersticken einer entstehenden Frauenöffentlichkeit, die nicht sein durfte, weil neben der "öffentlichen" Öffentlichkeit, in den dafür vorgegebenen Formen, nichts sein durfte. Deshalb wurde diese Fraueninitiative reguliert, enteignet und zur Privatisierung gezwungen. Von daher steht für mich der Zusammenbruch, der Bankrott dieses kontrollierenden, einengenden und ausgrenzenden Herrschaftsapparates allemal für Befreiung.
Mit den "Verlusten" verhält es sich komplizierter, auch bewegen sie sich überwiegend im Reich der Mutmaßungen: Ich befürchte, daß mir (und anderen) in meinen alltäglichen BRD-Bezügen, Horizonte des Denkens und Kritisierens und Räume des Handelns enger gezogen werden. Denn nun (nach dem befreienden Zusammenbruch in der DDR) kommt die lang verdeckte Wahrheit endlich zum Vorschein: Wir leben im besseren, wenn nicht gar im besten Deutschland. Da gehen dem kritischen Denken und Handeln zunehmend seine Relationen verlustig.
Vor allem fürchte ich Verluste für die weiblichen Lebenswelten und -lagen: Mit dem Zusammenbruch der DDR ist ja auch das klassische Modell der Gleichberechtigung (in seiner realexistierenden DDR-Spielart: Gleichverpflichtigung) zusammengebrochen. Bei allen grundlegenden und speziellen Kritiken beruht dieses Modell auf einer inhaltlich und organisatorisch möglichen Trennung von Berufstätigkeit und Privatheit für Frauen, einem Sachverhalt, der meines Erachtens eine wesentliche Voraussetzung weiblicher Autonomie ausmacht. Auf die Wichtigkeit einer solchen Trennung wird, so fürchte ich, künftig noch weniger politische Energie verschwendet werden als bislang schon. Vielmehr wird die Metapher von der "Wahlfreiheit zwischen Familie und Beruf" noch breiter und triumphierender Platz ergreifen. Folglich werden Frauen noch häufiger und routinierter als bisher (während der letzten zwanzig Jahre) ihre individuellen Drahtseilakte auf dem schmalen Grat dieser Wahlfreiheit (ohne Netz?) vollbringen. Das schluckt Energien und vereinzelt, vervollkommnet jedoch akrobatische Fähigkeiten.
Barbara Rose, Juli 1990
Zettel über Gewinn- und Verlustrechnung
Verlustig geh ich der dumpfdeutschen, kritikabtötenden Hinweise, doch nach drüben zu gehen (die zwar inzwischen weniger in dieser Offenheit formuliert wurden, dennoch in jedem "...und in der DDR, hä?" präsent waren), wie auch deren "linker" Spielart, dort sei alles, oder doch ein weniges besser. Wahrscheinlich einer meiner biografischen Zangengriffe.
Verlieren werde ich persönlich aber auch meinen privaten "Eisernen Vorhang"; mein West-Süd-Zentrismus hat schon heftige Risse. Bequemer wirds nicht, realistischer allenfalls.
Verlieren werden wir vollends die säkularisierten Religionen der Geschichtsphilosophien von links, denen zufolge das gute dicke Ende sowieso folge, wie auch deren bürgerliches Pendant, das postmoderne Geseiere vom Ende der Geschichte, wo doch eine neue Runde im melodischen Tanz eingeleitet ist. Befreiung also.
Befreiend wird es sein, wie die zur neuen Religion remutierte Soziale Marktwirtschaft mit ihrer allgemeinen Ausbreitung zugleich ganz universell ihre Legitimation verlieren wird, da sie in ihren Widersprüchen westostwärts real (!, nicht als Kampfbegriff einer Bürokratenkaste) kenntlich wird, wie auch, ihren Blockgegenpart schluckend, Blähungen nicht mehr systemextern projizieren kann.
Befreiend wird es sein, daß festgefahrene Politikmuster und Legitimationsstrukturen in sozialen Bewegungen, in linker wie rechter Politik, innenpolitisch wie außenpolitisch, in der EG wie darüber hinaus brüchig geworden sind, die Spielräume für linke, reformerische Politiken weiter werden.
Fraglich ist jedoch, ob dieser Zettel nicht eher in die Hände einer politischen Psycho-Analyse gehört, statt Teil eines Artikels zu werden. Zuviel verschränkte Blicke, zuviel Projektionen noch hier. Tja ...
Eberhard Bolay, Juli 1990
Der proletarische Prometheus liegt noch immer in Fesseln
Lieber Niko, lieber Wolfgang,
nun bin ich extra früh nach Hause gekommen, um den Brief zum Thema "Verlust und Befreiung" zu schreiben. Oft habe ich an Texten herumprobiert in der letzten Zeit: es ist mir nicht gelungen.
Was also tun? Warum nicht mit den Gefühlen anfangen? Also: mir wird übel - wenn ich Kohl sehe, wenn ich die Wetterkarte im 1. sehe, wenn ich die Kommentare in "Morgenpost" oder "taz" lese; ich werde wütend, wenn ich das Wort "soziale Marktwirtschaft" höre; ich werde zynisch, wenn das Attribut "ökologisch" hinzukommt; ich werde depressiv, wenn ich Leute von "drüben" reden höre - depressiv trifft wohl am ehesten meine gesammelten Sentiments zum Thema Anschluß und Kolonisierung. Also doch ein Überwiegen des "Verlusts"? - also keine Befreiung? Ich fürchte, so ist es.
Nein, so nun auch wieder nicht. Nicht der "Verlust" an sozialistischer Perspektive in der DDR ist es - da haben wir doch immer schon gute Gründe gehabt, Stalinismus und Sozialismus zu unterscheiden - es ist vielmehr der gesamtdeutsche Rechtsruck, der sich in dramatischer Geschwindigkeit vollzieht: sozialchauvinistisch bei der SPD, national-reaktionär bei der CDU, Öko-nationalistisch bei den Grünen, diversen "Linken" und "Alternativen" - noch die Parole "Nie wieder Deutschland" huldigt dem Nationalismus (wenn auch wider Willen). Manchmal allerdings ist mir die Position der "einfachen" Negation der "Radikalen Linken" sympathisch, es reizt vielleicht zum Warten auf "bess're Zeiten". Meistens allerdings ist es nicht so - jetzt könnte ich wieder von vorn anfangen. -
Versuch einer Analyse dieser Gemütslage:
1. These: Das Reservoir an bürgerlich-kapitalistischer Hegemonie scheint unerschöpflich, solange die Konnotation: Volk - Nation - Parlamentarismus = soziale Marktwirtschaft klappt. Oder umgekehrt: Solange die Konnotation: Volk = Klasse = Demokratie nicht klappt.
Ihr habt recht: es sind die alten Begriffe. Aber wenn wir nicht in der Lage sind, die alten Begriffe zu besetzen, z.B. in der Klasse nicht die Homogenität, sondern die Vielfalt der Subjekte zu sehen, kommen wir nicht von den unsinnigen Versuchen weg, die Begriffe "Nation" oder "soziale Marktwirtschaft" von links besetzen zu wollen. Also: Was ist der Kitt sozialistischer Entwürfe - die "funktionalen Äquivalente" zu "Nation", "sozialer Marktwirtschaft" usw. ? Das klingt alles sehr idealistisch? Nicht, wenn die Begriffe subjektiven Sinn und gesellschaftliche Bedeutung objektiver Strukturen zugleich ausdrücken. Das heißt, es geht um die Frage der "Lebensweise", der "tätigen Existenz".
2. These: Der proletarische Prometheus liegt immer noch in Fesseln. Meine Hoffnung, er könne sich befreien, hat getrogen. Aber: Es gibt ihn noch! Wenn auch zu den alten Fesseln eine weitere gekommen ist: Ein Knebel, der ihm sogar das Schreien nimmt.
Weniger poetisch: Die Frage des alternativen "Way of life", der proletarischen Zivilgesellschaft, bleibt weiterhin richtig gestellt, nur die Antworten werden komplizierter. Wahrscheinlich bedarf es einer genauso fundamentalen Krise in der kapitalistischen Hauptmacht, den USA, um diese Frage wieder in eine politisch relevante Öffentlichkeit zu bringen. Bis dahin liegen meine Hoffnungen weiterhin in den widersprüchlichen Versuchen in Lateinamerika, Afrika und Asien: Ich kann mir einfach nicht vorstellen, daß diese Gesellschaften weitermachen wie bisher.
Dazu: Wir sollten unsere Denkgewohnheiten in bezug auf Linearität (Ent/Wicklung) und Sprünge/Synthesen überdenken: wie Gramsci die einhundertfünfzigjährige Transformation der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften studierte, sollten wir die der siebzig Jahre Sozialismus analysieren: Vielleicht sind wir gerade bei Louis Bonaparte (Gorbatschow) abgekommen - gemeinsam den "18. Brumaire" studieren!
(Beim Schwelgen in den Weiten der Geschichte löst sich mir der Kloß im Magen!)
3. These: Befreiung?
Ja - doch: vom Gefühl in einer langweiligen Zeit zu leben!
Bis bald!
Euer Timm (Hamburg, 18. Juli 1990)
Anmerkungen zum "Prometheus in Fesseln":
"Der proletarische Prometheus liegt immer noch in Fesseln", schreibt Timm Kunstreich und spielt damit an auf seinen Aufsatz: "Prometheus in Fesseln?" im Widersprüche-Heft 18/1986: "Im Osten nichts Neues?". Timm Kunstreich hatte hier, noch voll von Eindrücken einer gemeinsamen Studienfahrt in die DDR und mit Gramsci im Kopf und im Herzen versucht, den "Realen Sozialismus" mit Gramsci zu verstehen: Als Resultat einer - problematischen - Staatswerdung der Arbeiterklasse. Die zentrale These: Es handelt sich um eine "blockierte Transformation"; die herrschende Gruppe konnte nicht zur führenden, hegemonialen Klasse werden. Diese Blockierung ist die Ursache für die rigide Pädagogisierung der Gesellschaft, für die "Staatsvergottung", für das unsinnige "Einholen und Überholen"(-Wollen) des Kapitalismus in der Produktion. Trotzdem seien "Elemente sozialistischer Vergesellschaftung und einer proletarischen Öffentlichkeit" ausmachbar. Prometheus' Fesseln würden wohl noch einige Zeit festgezurrt bleiben, befürchtete Timm Kunstreich 1986; trotzdem hoffte er auf einen politischen Prozeß, der zur "Rücknahme des Staates in die Gesellschaft" führen könnte.
Niko Diemer
Gute Gründe für radikales Abschiednehmen
Bei abwägenden Überlegungen, ersten Gedanken und den Gefühlen zum Ende der DDR und dem Beitritt zur Bundesrepublik gibt es zunächst viel Skepsis, Bedenken, Sorgen und Ängste: von der nun hemmungslosen Durchkapitalisierung, den sozialen Folgen und materiellen Verschlechterungen, der "Enteignung" der Revolutionäre, der Schnelligkeit des vom Westen gesteuerten Prozesses ohne Lern- und "Schon-"Zeit, der fehlenden (Zeit für die) Aufarbeitung von Nationalsozialismus und Stalinismus bis hin zu den Wahlergebnissen und politischen Mehrheiten; es gibt aber auch eine seltsam anmutende Weinerlichkeit und Sprachlosigkeit innerhalb der "Linken", daß nun der Sozialismus endgültig diskreditiert sei, sowie die generelle Einschätzung, daß ein neuer Nationalismus und eine Großmacht Deutschland unter konservativer Hegemonie entstehen würden. Darüber hinaus gibt es enttäuschte Hoffnungen, daß aus der ehemaligen DDR nicht eine über die Bundesrepublik hinausgehende demokratische, sozial(istisch)e, ökologische Gesellschaft geworden ist, organisiert in einem eigenen Staat; erkennbar werden Projektionen für einen Hoffnungsraum unerfüllter Utopien (Rathenow).
Diese Bedenken, Ängste und Skepsis können mit guten Argumenten belegt werden, sie haben viele Gründe auf ihrer Seite und sie bestimmen weitgehend auch meine Einschätzungen und Gefühle. Beim Abwägen von Argumenten und Ambivalenzen dominiert bei mir jedoch eine positive Einschätzung. Dem spät-stalinistischen SED-Staat kann nichts, aber auch gar nichts abgewonnen werden; ihm kann keine Träne nachgeweint werden. Die Argumentationskette für diese Einschätzung reicht vom Fehlen jeglicher Demokratie, von Menschen- und Freiheitsrechten, der Repression, Gängelung und Bespitzelung der BürgerInnen, Kommandopädagogik in Schule und FDJ, Kaderpolitik in allen gesellschaftlichen Bereichen bis hin zu kultureller Langeweile und Öde, ökologischen Katastrophen unvorstellbaren Ausmaßes. Die Liste ließe sich um einige Seiten Papier verlängern und führt zu einer Bilanz, über die man sich eigentlich nur freuen kann: daß spät-stalinistische Gesellschaften und marxistisch-leninistische Gesellschaftsvorstellungen sowie ihre Revolutionskonzepte endgültig zur Geschichte gehören. Ihre notwendig kritische Aufarbeitung steht an, dabei steht uns "die bitterste Erfahrung aus all den Erfahrungen analytisch noch bevor" (Rathenow).
Vor allem zwei Überlegungen bestimmen meine unverhohlene Freude über das Ende des SED-Staates (Lutz Rathenow spricht von "Sozialgefängnis") und die friedlichen Übergangs- und Veränderungsprozesse: einmal die historische Einordnung und Wertschätzung (nicht Verklärung) von parlamentarischer Demokratie, von Rechts- und Sozialstaat, von Freiheits- und Menschenrechten, hinter deren Entwicklungsstand nicht mehr zurückgefallen werden darf; dabei stellen sich auch Fragen nach der Regulation gesellschaftlicher Prozesse wie Markt, materieller Versorgung (Wohlstand), nach Innovation, Kreativität und Anreiz in aller Radikalität.
Zum Zweiten wird sich jetzt zeigen müssen, wie die wirklichen sozialen, ökologischen Probleme, Menschheits(überlebens)fragen, das Verhältnis zur Dritten Welt, u.v.a. Fragen beantwortet und gelöst werden. Auch bei aktueller konservativer Hegemonie, latentem (und manifestem) Nationalismus und Eurozentrismus ist das ein Prozeß mit offenem Ausgang. Aber noch mal zum Prinzipiellen: eine (auch konservativ regierte) freiheitliche Demokratie und eine kapitalistisch organisierte Marktwirtschaft bieten mehr Möglichkeiten und Chancen für gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen als die ehemals realsozialistisch verfaßten Gesellschaften mit ihrem Kommandowirtschaftssystem. Welche Antworten die nun in Ost und West parlamentarisch und marktwirtschaftlich verfaßten Gesellschaften entwickeln, wie sie sich unter den jeweiligen Kräfte- und Mehrheitsverhältnissen weiterentwickeln und welche neuen (sozialistischen?) Utopien sich aus den wirklichen Verhältnissen und Erfahrungen, welche Wege von Veränderung sich entwickeln und wer sozialer Träger ist, ist offen und gilt es zu beeinflussen. Der Verlauf dieser Prozesse ist nun unabhängig von (altem) ideologischen Ballast, von falschen Kontroversen und ökonomischer, militärischer und ideologischer Blockkonfrontation; umzusetzen auf der Basis (der weiter zu entwickelnden) Demokratie, Menschen- und Freiheitsrechte. Es gibt für mich keinen Grund für Melancholie oder Weinerlichkeit, aber auch keinen für Überlegenheits-, Siegerposen, für Selbstgerechtigkeit und trügerische Arrangements; es gibt aber Gründe für radikales Abschiednehmen von historisch überholten Gesellschafts- und damit verbundenen Veränderungskonzepten - die mehr Probleme geschaffen wie gelöst haben - um den Kopf frei zu haben für kritische Aufarbeitung, für neues radikales Denken, die Diskussion über Reichweiten von Utopien, über problematische (und falsche) Begriffe u.v.a. - es gibt mehr Fragen als Antworten, enormen Klärungsbedarf und vor allem die Notwendigkeit, sich auf Erfahrungen einzulassen; in einer Prognoselandschaft, die sich für die ehemalige DDR zwischen Wirtschaftswunder und Sozialkatastrophe bewegt.
Benno Hafeneger, 18. Oktober
Nicht einfach: Erinnerung und Abschiede
Sicher, nicht mein Sozialismus ist gestürzt (worden). Aber ich bleibe nicht unberührt.
Die Fragen der letzten Jahre stellen sich verschärft. Und, wo der Sturz des einen Falschen als Sieg des anderen Falschen gefeiert werden kann - öffnet sich da Raum für das Richtige? Zunächst ist da das Gefühl der Ohnmacht, ein Mitgefühl mit denen, die übermächtigt werden.
Ist es nicht entmutigend, wenn fast ein Jahrhundert Kampf gegen Elend und Herrschaft, soviel Mut und Kräfte (Sturm auf das Winterpalais, in Eisensteinschen Bildern) vergeblich waren, sinnlos, wenn der "Rote Oktober" weggewischt wird - und nicht revolutioniert - als autoritär-militaristischer Industrialisierungstypus - von den Produzenten? Daß die Befreiung Umwege und Sackgassen geht, das wußte ich - aber solche Abbrüche der Geschichte? Ich spüre, daß sich mein ganz persönlicher Entwurf (im Sartreschen Sinne), mein Bogen zwischen existentiellem Widerstand, Adornoschem Leidens-apriori und (männlichem) Kampf-Heroismus mit allen Fasern gegen dies faktische Dementi einer langen Kampfgeschichte sträubt - trotz neu-linker Gebrochenheit im Verhältnis zum roten Stern.
Einiges an Leit-Bildern (Eisensteins Treppe) und (oft geirrt habenden) Vorvätern und -müttern, die für das "Revolution ist gerechtfertigt" standen, verliere ich noch gründlicher. In meinen Gefühlen stürze ich hart ab, dahin, wo ich theoretisch schon längere Zeit bin: daß es kein historisches Modell für unsere Revolution gibt, daß Befreiung - angesichts der "Dialektik der Aufklärung" - nur als "Politik der Differenz" (jenseits gesellschaftlich-rationaler Glücksproduktion, jenseits Natur- und Geschlechterbeherrschung) noch möglich sein kann. Aber erst mal wird gesiegt: Der Kapitalismus hat gesiegt, und das nicht in Form universalistischer Vernunftverbreitung, sondern als aggressiver und polarisierender Nord-Block an der Schwelle eines Krieges gegen den armen Süden der Welt - in dem Augenblick, da die (reale oder imaginäre) Grenzziehung gegen die Übermacht seitens eines Ost-Block weggefallen ist. Verlust also eines weltpolitischen Widerparts gegen allzu unverschämten Imperialismus (ohne Afghanistan, Prag 68 und viele Stellvertreterkriege zu vergessen). Mir graut vor der einen Welt. Sieg jedenfalls: DM-Anschluß und "ursprüngliche Akkumulation" und kein harmonisches "Mitteleuropa" im Norden und gun-boats vor "unserem" Öl im Süden - keine Idylle à la Dieter Senghaas' "Europa 2000" oder ein Szenario "brandtistischer" Welt-Genesung à la Lothar Baier (im letzten Kursbuch Nr. 100).
Ein anderer Verlust betrifft politisch-sozialpsychologische Hoffnungen, daß den Menschen soziale Beziehungen, eine halbwegs egalitäre Sozialität wichtiger sein könnten als die Warenfetische und die Raserei danach, daß sie eine gewisse Langsamkeit ihrer Welt verteidigten und daß - trotz verordnetem Antifaschismus, bürokratischer Bevormundung und Infantilisierung - die Regression in Rassismus und Nationalismus weniger wahrscheinlich geworden sein könnte. Verlust von Illusionen, ich lerne es langsam.
Ich komme zum Schwierigsten: Der schlimmste Verlust ist die faktische Revision der Niederlage des deutschen Faschismus. Deutschland hat doch noch gesiegt - die Inszenierung des Auslaufens der Kriegsschiffe in Wilhelmshaven ist der jüngste Akt des Siegers, nach einer Kette unsäglicher Arroganz (gegenüber den Polen) und ökonomischer Brechermentalitäten. Der narzißtischen Wunde wurde Heilung zuteil durch die Eroberungsfeldzüge der DM und durch die "Heim-ins-Reich-Kehrer" mit fliegenden Fahnen (und Bananen) - und alles, was an Vergangenheit erinnern könnte (und das tut in der DDR jede Mauer) muß entwertet oder mit westlichem Plastik verdeckt werden: Wirtschaftswunder-Amnesie, jetzt im ganzen Reich - und die Niederlage und, vor allem, Auschwitz ist getilgt. Ich habe Angst vor diesem, sich täglich beschleunigenden, Sieg und erschrecke über die gesteigerten Rassismen und Ausgrenzungen drüben und hier. Nur wenig tröstet mich, daß die pure nationalistische Mobilisierung nicht ganz so klappt, daß die Lust, für "Deutschland" zu opfern, nicht ganz so groß zu sein scheint.
Gut, ich weiß, daß die Denk- und Gefühlsfigur, die deutsche Teilung sei eine gerechte Strafe für Auschwitz, eine Mystifizierung der Nachkriegskonstellation ist, dazu noch eine Verzerrung, denn bestraft worden ist die Hälfte DDR, zuletzt eine autoritäre Figur ist, die davon ausgeht, daß ein Böses nur durch Teilungsgewalt bezähmt werden könnte. Vielleicht bedeutet ja die Auflösung der "Front", der "Grenze" als Externalisierungsmechanismus (vgl. Peter Brückner), als Delegationstechnik mitsamt Rückschlag ins eigene Denken (Anti-Antikommunismus, Anti-Antifaschismus) wirklich eine kleine Befreiung.
Eine Konfrontation mit dem ganzen Deutschland, mit Weimar und Buchenwald und die Neumischung der diversen Deutschländer befreit vielleicht die Linke aus ihrem erstarrten anti-deutschen Manichäismus aus purer Abwehr des Nahen und romantischer Projektion nach weit weg. Aber, läßt die grassierende Siegermentalität Raum, Raum für Erinnerung vor allem? Gibt es nicht einen so massiven Identifizierungszwang mit dem siegreichen Aggressor bis beispielsweise in Udo Knapps Kriegsspiel-Lust hinein?
Und noch ein Verlust: Wir verlieren die BRD, die wir durch stetige, manchmal auch wirklich blinde Maulwurfsarbeit seit 68 verändert haben. Befreiung? Fast schon wieder vergessen, daß es Menschenmassen waren, die mit bloßen Händen, Kerzen und auch Fäusten und Steinen moralisch bankrotte Regimes gestürzt haben - alle Stasis, Vopos, Panzer und ZKs waren lächerlich. "Ein Lachen wird es sein..." Wirklich befreiend waren die Bilder anfang November von den Gesichtern, die plötzlich die Angst verloren hatten. Keine Angst mehr, trotz Tien-an-men. Aber dann? Diese Selbstentwertung, dieses Rasen nach den Waren, diese schiefe "Vergangenheitsbewältigung" zweier Vergangenheiten, Faschismus und SED gleichsetzend und damit abwehrend jede konkrete Kränkung, Mittäterschaft und Trauer ... Befreiung unseres Sozialismus? Sicher, festhalten am industrialistisch-autoritären Realsozialismus werden nur wenige Unentwegte in der Linken. Aber Denken ist schwierig, denn der pure Distanzierungszwang von allem Linken ist massiv: "Kapitalismus" darf man kaum mehr sagen. Habermasianische und postmoderne Evolutions-Heiligenbildchen werden rege getauscht; eine "antitotalitäre" "Westorientierung" hat gewaltige hegemoniale Schubkraft. Nicht einfach: Erinnerung und Abschiede, Kritik und Dissens denken unter Bedingungen einer siegreichen Übermacht. Schwierige Zeiten...
Niko Diemer, August 1990
Wir verstehen diese Gesellschaft noch längst nicht genug
Randnotizen
I
Eine Freundin aus Spanien schrieb mir im Dezember letzten Jahres, sie wäre jetzt gerne hier, wo sich doch bei uns soviel verändere. Ich schrieb ihr, selbst verwundert über diese doch einleuchtende Vermutung: Hier, im Westen, bewegt sich nahezu nichts. Wir sitzen wie gebannt vor dem Fernseher. Als sie mich im Januar besuchte, war sie als erstes entsetzt darüber, daß hier in den Nachrichten fast nur Deutschland zählte.
Meine Randnotizen beziehen sich auf die westlichen Reaktionen der östlichen Ereignisse, und zwar die der linken Oppositionellen hier im Lande. Es geht mir um unsere Sicht der Dinge und die darin möglichen Veränderungen.
II
Immer wieder wird der "Verlust der Utopie" beklagt oder beschwörend darauf Wert gelegt, daß "wir" an der Utopie des noch nicht realen, originären Sozialismus festhalten wollen bzw. sollen. Ganz abgesehen davon, was schon lange über den "realen Sozialismus" bekannt war: Warum überhaupt soll es notwendig sein, eine "gute" Vorstellung vom Sozialismus oder einer anderen Gesellschaftsutopie im Sinne eines Modells zu haben, um die jetzigen Zustände, die jetzige Gesellschaft kritisieren zu können? Warum muß immer wieder ein anderer Entwurf her, muß man einen großen alternativen Plan haben? Wir verstehen doch diese Gesellschaft noch längst nicht genug.
Um nur ein Beispiel anzuführen: Nicht ohne Grund zeigen Teile der Frauenbewegung und feministischen Forschung, daß das Bemühen um fundierte Kritik und umfassendes theoretisches Verstehen der (patriarchalischen) Gesellschaft auch ohne ein Gegenmodell möglich ist. Wo haben linke Männer bisher allen Ernstes die Fragestellungen der Frauenbewegung, die Diskussionen und (doch wohl irritierenden) Ergebnisse der Frauenforschung zu Kenntnis genommen und sich damit, bezogen auf ihre linken Theorien wie auch ihre eigene männliche Situation, auseinandergesetzt? Warum interessieren die Differenzen so wenig, die Einzelheiten, die höchst unterschiedlichen Erfahrungen? Wo bleibt die Neugier?
III
Mir fällt bei Podiumsdiskussionen, TV-Gesprächen und anderen öffentlichen Veranstaltungen, zu denen DDR-BewohnerInnen eingeladen werden, immer wieder folgendes auf: diese Leute werden zuallererst mit Interpretationen und Einschätzungen der politischen Entwicklung durch Westler konfrontiert, wozu sie sich dann äußern sollen und dürfen. Dies geschieht zuweilen in der "besten (auch linken) Absicht". Es wird ständig verkannt, daß wir kaum ein Verständnis dessen haben, was alltägliches Leben und was Opposition "drüben" genau bedeutete und bedeutet. Immer wieder werden erneut Chancen vertan, aus erster Hand mal mehr zu erfahren, wozu es doch jetzt weit mehr Möglichkeiten gäbe. Dieses Phänomen ist natürlich nicht neu. Wir kennen es aus anderen Zusammenhängen, wo "Betroffene" kurz zu Wort kommen sollen.
IV
Kann man inzwischen das Etikett "sozialistisch" allen Ernstes noch aufrechterhalten? Natürlich kann und wird man, aber (glücklicherweise) hat das jetzt ganz offen zutage liegende Folgen: Man wird noch deutlicher "mißverstanden" als vor dem Ende des "realen Sozialismus". Natürlich kann man versuchen, sich dagegen abzusichern, mißverstanden zu werden, indem man auf seiner ureigenen Definition und Vorstellung des Wortes gegenüber allem "feindlichen" Sprachgebrauch, allen schrecklichen, (un)menschlichen Erfahrungen, die nun mal mit diesem Wort zusammenkamen, allen Konnotationen zum Trotz, einfach besteht.
Doch es wird sich, denke ich, nicht machen lassen. Es sei denn, man erklärt insgeheim die große Anzahl derjenigen, die dies zu Recht nicht mit ihren Erfahrungen in Einklang bringen können, für dumm (auch das wäre kein neues Phänomen). Es wird sich immer weniger machen lassen, ohne daß die AdressatInnen wegbleiben. Und das ist gut so. Es könnte eine Chance sein für genauere, bessere Diskussionen. Politisches Engagement und theoretische Radikalität werden sich vielleicht immer weniger an der Beibehaltung von globalen Theorien, Modellen und Begriffen messen lassen. Das Beharren auf "unseren" als "enteignet" angesehenen Begriffen beruht zudem auf einer Verkennung von Sprache. Die lebt und verändert sich mit ihrem Gebrauch, und das läßt auch theoretische und vor allem politische Sprache nicht völlig ungeschoren. Begriffe können von keinem tatsächlich besetzt werden, ohne den Preis der Versteinerung und Sinnentleerung, wofür ja nicht zuletzt der gescheiterte "Real-Sozialismus" bestes Beispiel ist.
Ich halte es für fatal, wenn wir wie gebannt allein auf die (doch eigentlich altbekannte) Rede der kapitalistischen "Sieger" hören und unser Vokabular danach ausrichten. Wird diese zum Schauplatz eines Kampfes erhoben, bleibt allerdings die Rede der "Sozialismus"-Geschädigten erneut zweitrangig. Deren Rede wurde bisher noch kaum vernommen.
Gisela Wölpert. 21. Oktober 1990
Verloren habe ich die Existenz von zwei Deutschlands
1. Die Frage nach dem Verlust angesichts der Veränderungen in der DDR und Osteuropa kommt mir befremdlich vor. Denn das Faktum des Sturzes der autoritär-bürokratischen Regimes kann von mir nur als positiver, befreiender Schritt gesehen werden. Zumal der Sturz der Regimes Ergebnis der Selbsttätigkeit der gegängelten, pädagogisch behüteten, unterdrückten und im System der Herrschaft auch mitmachenden, angepaßten Bevölkerung war. Freilich spielt die Politik Gorbatschows als äußere Rahmenbedingung ("find your own way") eine Rolle und die Angepaßtheit und Mitmachbereitschaft war in den Ländern verschieden. Daß dabei im Fall der DDR auch eine Massenfluchtbewegung mindestens genauso wie Einzel-, Gruppen- oder Massenwiderstand im jeweiligen Land entscheidende Hebel der Veränderungen waren, ändert am befreiend-freudigen Charakter der Ereignisse nichts. Denn beide Handlungsweisen drücken aus, daß die bürokratisch-vergesellschaftete Lebensweise für die Mehrheit der Menschen nicht mehr tragbar war.
2. Aber kaum rufe ich mir die Faszination darüber, daß die oben nicht mehr konnten und die unten nicht mehr wollten, ins Gedächtnis, so kommt es zum ersten Verlust: daß nämlich im Fortgang der Befreiung in der DDR sich keineswegs eine Alternative zu beiden großen Herrschaftssystemen ergab, zwischen denen und gegen die wir als undogmatische Linke in unserer kurzen persönlichen Geschichte mit unseren politischen Einmischungen standen. Daß wir in dieser kurzen Geschichte auf nichtleninistische, nichtorthodoxe Vorläuferinnen in Theorie und Praxis zurückgegriffen haben, ist auch kein Trost.
Aber die Trauer um die nicht verwirklichte, nicht mögliche (?) Alternative ist keine Trauer um das Ende des realexistierenden DDR-Systems, dieses Oberpädagogen, der sich selbstherrlich als sozialistisch klassifizierte, aber mit einer freien Assoziation der ProduzentInnen wirklich nichts im Sinne hatte - wieviel diese selber damit im Sinn hatten, lasse ich mal dahingestellt. Das ist die Trauer darüber, daß meine Träume mal wieder nicht in Erfüllung gegangen sind; daß die, die im Widerstand den größten Mut und die meisten Opfer aufbrachten, wieder die Gelackmeierten sind; daß wesentliche Elemente der westlichen kapitalistischen Industriegesellschaften von der DDR-Bevölkerung als positive Momente begriffen werden: Marktwirtschaft, Leistung, Konkurrenz.
3. Jetzt kann mir zwar niemand mehr dümmlich sagen "geh doch nach drüben", was ich soundso nicht gemacht hätte. Aber was hieß denn "geh doch nach drüben" als Antwort auf jede Opposition gegen die BRD-Gesellschaft wirklich? War es nicht auch Ergebnis dessen, daß die DDR und andere osteuropäische Staaten einen Alleinvertretungsanspruch als einzig vernünftige Alternative zur kapitalistischen Gesellschaft formuliert hatten und wir mit unserem Anti-Anti-Kommunismus (wir wollen keine falschen Freunde, zurecht) und ohne vorweisbare lebendige, lebbare Alternative zur existierenden Gesellschaft mit ihnen in einen Topf geworfen worden sind. Hier gab es ja bis zum Einzug der Grünen in die Parlamente, in die realpolitische Öffentlichkeit, keine breite alternative politische Kraft, die von großen Teilen der Bevölkerung auch als solche ernstgenommen wurde. Jede noch so undogmatische, emanzipatorische "Bewegung" traf auf eine Mauer des "entweder hier oder drüben". Dieses bornierte Bewußtsein der Mehrheit, das nur entweder/oder bzw. gut/böse kannte, war verhärtet, wie das der stalinistischen Betonköpfe, die auch nur entweder/oder - gut/böse - Feind/Freund kannten.
Die Identifizierung von Veränderungswünschen, Protest, Konflikt und Kritik mit dem "bösen Kommunismus" ist doch auch Ausdruck der Angst vor jeglicher Veränderung, Ausdruck der krampfhaften Verteidigung der eigenen alltäglichen Erniedrigungen und Erfolge in der Konkurrenzgesellschaft. Daß sich im "geh doch rüber" auch eine mehr oder weniger bewußte Verteidigung der Freizügigkeit dieser BRD-Gesellschaft ausdrückte, wage ich nicht zu behaupten. Die Angst vor Veränderungen als politisches Problem ist mit dem Ende des SED-Staates nicht weg. Im Gegenteil. Es kann uns zwar kein falsches Idol mehr vorgeworfen werden, aber es kann uns vorgehalten werden: es geht, politisch, aber vor allem ökonomisch nur so wie hier. Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft - und es wäre ein schwerer Verlust, sie nicht mehr als solche kennzeichnen zu wollen - kann nun aus der Siegerpose heraus mit Anhängerschaft von überwundenen, blamierten gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen gleichgesetzt werden. Das Problem einer realisierbaren radikalen Reform - oder wie auch immer - Alternative habe ich aber nicht erst seit dem Ende des SED-Staates. Und daß ich da nicht allein stehe, weiß ich. Aber in dieser Frage nach einer Wirtschaftsweise, die die völlige Dominanz der ökonomischen Vernunft, der abstrakten Arbeit und des Raubbaus an der "Umwelt" überwindet und solidarische, gerechte und nichtzerstörerische Verhaltensweisen und Verhältnisse ermöglicht, bin ich noch mehr verunsichert.
4. Verloren habe ich die Existenz von zwei Deutschlands, nicht nur auf der Wetterkarte. So pervers und unmenschlich-gefängnishaft die BRD/DDR-Grenze war, so bekannt und normal war sie mir seit der Kindheit. Ich kam immer wieder an Stellen, wo es nicht weiterging, weil da die DDR anfing. Jeder Transit nach West-Berlin, jeder Übertritt in die DDR erregte mehr als andere Grenzen meine Anti-Controlletti-Gefühle. Dennoch waren die beiden Staaten für mich Fakt - unabhängig von ihrer jeweiligen besonderen miesen Qualität. Sie waren Fakt. Und der deutsche Faschismus und der II. Weltkrieg waren die Ursache. Insofern habe ich diese Teilung als richtig und gerecht verinnerlicht und jeder Wunsch nach Überwindung dieser Teilung, jede Diskussion der sogenannten nationalen Frage in der Linken und wo es üblich ist, erregte Grausen in mir. Gewünscht hätte ich mir normale Beziehungen und Reisemöglichkeiten wie nach Italien oder Österreich. Als Ergebnis des Wunsches nach Einheit, nach "einig Vaterland" konnte ich mir - und nach dem Gang der Ereignisse geht's immer mehr so - nur die "Befreiung" von der Erinnerung an den Faschismus vorstellen. Es gibt in mir die Angst davor, daß "Deutschland" wieder "ins Recht" gesetzt wird - selbst dann, wenn es keineswegs ein monströses "4. Reich" wird, sondern nur der stinknormale Nationalismus, wie er in anderen Ländern so selbstverständlich üblich und so übel ist.
5. Sind mit dem Ende des realen Sozialismus Utopien einer freien, gerechten, solidarischen, wirklich demokratischen Gesellschaft hinfällig? Nein. Denn die kapitalistische Industriegesellschaft kann die emanzipatorischen Träume nicht erfüllen, weder in den Metropolen noch in den anderen Teilen der Welt. Wenn mit dem Ende des realen Sozialismus Utopieverlust beklagt wird oder "der" Linken Ratlosigkeit, Sprachlosigkeit vorgeworfen wird, so steckt darin immer die Unterstellung, als seien die Gesellschaften wie die DDR Utopiemodelle gewesen. Sicher war die Oktoberrevolution ein Hoffnungsfunken und Hoffnungsträger für viele, doch wir können nicht so tun, als ob es nicht selbst um diesen Teil der Geschichte eine kritische Auseinandersetzung gegeben hat, und erst recht über die Verpanzerung der Revolutionen in stalinistischen VATERländern. Und in diesen politischen Auseinandersetzungen wurden Schritt für Schritt schon viele der kritischen Punkte benannt, die heute von manchen als furchtbar neue Erkenntnis zu Papier gebracht werden.
6. Die Diskussion um Erhalt oder Nichterhalt der "sozialen Errungenschaften des Sozialismus in der DDR" hängt mit dieser Frage und den Diskussionen um Utopien zusammen. Denn welcher Art waren diese Errungenschaften? Können wir Kinderunterbringungsmöglichkeiten, Arbeitsplatzgarantien, Bildungsmöglichkeiten für Arbeiterkinder etc. eigentlich "an sich" betrachten? Waren diese Errungenschaften nicht alle in ihrer Qualität bezogen auf die Grundnormen dieser Gesellschaft? Kinderunterbringungsmöglichkeiten, damit Frauen Erwerbsarbeit haben können. Zwar sagen auch wir, daß die Möglichkeit zur Erwerbsarbeit eine Emanzipationsbedingung ist, aber war die Möglichkeit der Frauenerwerbsarbeit in der DDR nicht "objektiven" Produktionserfordernissen und Planzielen untergeordnet? Ganz zu schweigen davon, daß die geschlechtliche Arbeitsteilung im großen und ganzen beibehalten wurde. Lassen sich die großen Kinderunterbringungsmöglichkeiten trennen vom Interesse des SED-Staates an der fürsorglichen politischen Indoktrinierung der Kinder? War die Arbeitsplatzgarantie, das Recht auf Arbeit nicht verkoppelt mit der Pflicht zur Arbeit, mit dem staatlichen Willen, alle Kräfte im sozialistischen Wettbewerb für das "Mehr", für das "Höher" einzusetzen. Die oft erwähnte "Produzentenherrschaft" oder der "Schlendrian" - je nach Sichtweise - war jedenfalls kein politischer Wille der herrschenden Bürokratie. Und Bildungschancen? Mit welchen "gesellschaftlichen Aufgaben", sprich Anpassungsleistungen an die herrschende Ideologie (JuPi, NVA o.a.) mußten sie erkauft werden?
Kurz gesagt, ich denke, wir sollten die "sozialen Errungenschaften" im Rückblick auch unter unseren eigenen Kriterien und Ideen betrachten, und schauen, in welcher Weise darin immer auch Herrschaft garantiert war. Dies ist sicher auch ein Grund dafür, weshalb es bei DDR-Bürgerinnen oft so widersprüchliche Aussagen gibt zwischen dem Beklagen von Verlusten von Garantien und dem Lob der Befreiungen durch Markt und Mark.
Wolfgang Völker, Juli 1990
Enttäuschung gehört zur Hoffnung - Oder was bleibt vom Fresko Sozialismus?
Es wird Zeit, die wirren Gedanken zu ordnen, Ruhezonen zu finden in diesen Monaten der Zeitraffer-Geschichte. Fangen wir einfach mal an mit ersten, noch sehr subjektiven Eindrücken, mit Gedanken zum Lauf der linken Dinge, mit dem Sammeln der vielen kleinen Scherben meines Bildes vom Sozialismus, das seit langem - und nicht erst seit 1989 - nur noch als Fresko existiert.
I
Eine Episode aus den Tagen im Spätherbst 1989. Längst strömten bereits die Massen aus dem Ostteil Berlins, aus der gesamten DDR durch die weit geöffneten Grenztore in den Westen. Jede und jeder, der hören, lesen und sehen konnte, wurde durch die Medien ununterbrochen aufgeklärt über das, was die DDR in all den Jahren ihrer Existenz zusammengehalten hat. Aus den anfänglich noch weit verbreiteten Überzeugungen, wirklich an einer aus den Ruinen des Faschismus neu entstandenen Alternative zum kapitalistischen Westdeutschland mitzuarbeiten, erwuchs immer mehr eine einzige große Mutation ehrbarer Ideale. Stasi, Repression bis in die feinsten Äderchen des Alltags und Lügen, wohin man hörte und schaute, standen am Ende des ersten antifaschistischen Arbeiter- und Bauernstaates auf deutschem Boden. Es waren keineswegs nur noch die üblichen rechten westdeutschen Medien und Kreise, die dieses Bild von der in jeder Hinsicht erschütterten DDR zeichneten, sondern selbst aktive Kader der SED-PDS bestätigten es schonungslos. Und in dieser Situation versammelten sich in München linke Medizinerinnen und Mediziner, um gemeinsam mit einem seit langem in der Friedensbewegung aktiven Schriftsteller den Stand der Ereignisse zu erörtern. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, war in der äußerst regen Diskussion jenes Abends nichts von einer Betroffenheit spürbar, in all den Jahren zuvor offen (oder vielleicht auch nur opportunistisch oder aus verständlicher Gegnerschaft zum vorherrschenden Antikommunismus) ein System verteidigt zu haben, in dem die Lüge Verfassungsrang hatte. Der Referent des Abends und die Mehrheit der Diskussionsteilnehmer verloren nur Nebensätze über die Inhumanität und jede Vorstellung von Demokratie spottenden stalinistischen Praktiken in der DDR. An allem war, wen wundert's bei diesem einfachen Weltbild, der Westen, der Kapitalismus, die Springer-Presse usw. usw. schuld. Für mich war an jenem Abend der Tiefpunkt einer irgendwie noch verstehbaren und tolerierbaren linken Moral und Glaubwürdigkeit erreicht. Aber diese Erfahrung war nicht einmalig, sondern wurde in der Folgezeit oft, wenn auch nicht immer in dieser Deutlichkeit, wiederholt. Aus diesen Erfahrungen resultiert meine zentrale These:
Ein Teil der westdeutschen Linken - wenn diese Generalisierung überhaupt noch einen Sinn macht - hat bis heute nicht begriffen, wie radikal seine politischen Leitideen neu durchdacht werden müssen, um trotz der bösen Erfahrungen so vieler Menschen mit sozialistisch etikettierten Systemen wieder leidlich als Ansprechpartner für gesellschaftliche Veränderungen akzeptiert zu werden. Und in dem Sog der diskreditierten sozialistischen Ideen sind, nolens volens, auch diejenigen Linken gefangen, die sich zu keinem Zeitpunkt mit dem Stalinismus identifiziert haben, sogar seine Opfer waren. Dem muß man sich stellen.
II
Lasse ich viele private wie politische Begegnungen seit Ende des letzten Jahres Revue passieren, dann gehörten verunsicherte Hilflosigkeit und verstockte Selbstgewißheit zu den vorherrschenden Reaktionsformen in linken Kreisen. Hilflos reagierten die Einen auf die stündlich eintreffenden Nachrichten von den Veränderungen in Ost-Mitteleuropa, die doch nur alle Urteile der politischen Gegner bei uns über den Sozialismus bestätigten und schon deshalb nur wenig Solidarität verdienten. Wie sollte man sich dazu verhalten, daß in Polen, Ungarn, der Tschechoslowakei, der DDR, Bulgarien und später dann auch Rumänien die Massen auf die Straßen gingen, und den Sozialismus, in welcher Variante auch immer, aus ihren Gesellschaften radikal herausreißen wollten? Daß etwa ein Alexander Dubceck, eine der großen Symbolfiguren des Euro- und Reformkommunismus in der CSFR nicht wegen, sondern trotz seiner linken Ideale akzeptiert wurde?
Wer nicht durch die Fernsehbilder, die Zeitungsberichte, die Gespräche mit Flüchtlingen aus jenen Ländern oder durch die eigene Anschauung verunsichert wurde, hielt (mit dreißig, vierzig, fünfzig Jahren!) altersstarrsinnig am Sozialismus fest, ohne sich wirklich einer genauen Definitionsklärung und Selbstkritik zu stellen. Mit großer Emphase verteidigte etwa bei einer DGB-Veranstaltung hier in München die noch sehr junge bayerische Juso-Vorsitzende den "demokratischen Sozialismus", weil sie und die "Sozialisten in der SPD" immer schon das System des "realen Sozialismus" kritisiert hätten.
Wann und wie aber haben die Linken, die sich heute so spektakulär und wohlfeil zu den Gegnern des Stalinismus rechnen, in der Vergangenheit die reale Opposition in den irrealen sozialistischen Staaten wirklich unterstützt? Solidarnosc, Charta 77, rumänische Schriftsteller, kirchliche Friedensgruppen in der DDR, oppositionelle Intellektuelle in Ungarn können ein Lied von dem "einäugigen" Internationalismus westlicher Linker singen. Es wäre ein einziger großer Trauergesang, hätte es nicht Ausnahmen gegeben, für die hier einmal stellvertretend ein Heinz Brandt, eine Ursel Schmiederer, ein Rudi Dutschke oder auch eine Organisation wie das SB genannt seien.
III
Ohne rücksichtslose Erinnerungsarbeit und spürbare Bereitschaft, aus den Erfahrungen des "Bürgerfrühlings in Osteuropa" (Timothy Garton Ash) zu lernen, ohne Angst vor Brüchen mit unhaltbaren Selbstgewißheiten, wird es für Linke schwer werden, je wieder eine größere Massenakzeptanz zu gewinnen. Die Nonchalance, mit der zum Beispiel in vielen kleinen Kreisen über die Errungenschaften des bürgerlichen Rechts hergezogen wurde, kann man sich nach den Erfahrungen mit "sozialistischen Rechtssystemen" einfach nicht mehr leisten. Daß bürgerliche Freiheitsversprechen immer ambivalent sind - kalter Kaffee, aber welche Alternativen dazu ließen sich denn denken und realisieren? Wer je mit Menschen gesprochen hat, die jahrzehntelang bürokratischer Willkür (im Namen des Sozialismus!) ausgesetzt waren, wird vorsichtiger in seiner Kritik an bürgerlichen Freiheitsrechten.
IV
In der Flut von Äußerungen zu den deutschen Entwicklungen seit dem Herbst des aufregenden Jahres 1989, stoßen wir immer wieder auf einzelne Gedanken, die uns besonders zu Kopf und Herzen gehen. Jede und jeder hat da sicherlich jeweils eigene Präferenzen, nach denen die klugen von den dummen Stellungnahmen unterschieden werden. Mir sind (neben anderen) besonders zwei Bemerkungen aufgefallen, die es wert sind, aufbewahrt zu werden.
Auf der dieses Mal ganz der "deutschen Frage" gewidmeten Frühjahrstagung der Evangelischen Akademie in Tutzing sah Ludwig Mehlhorn ("Demokratie jetzt") voraus, "daß diejenigen, die auf Erinnerung und Gedächtnis beharren, in Deutschland wieder eine Minderheit sein werden". Wer die Zeichen der Zeit, die Worte in den großen Reden und kleinen Alltagsplaudereien richtig zu deuten weiß, kann dieser Prophezeihung kaum widersprechen. In seinem im Umfang wie in der Qualität großen Essay "Der gebrochene Anfang" (abgedruckt in der Essaysammlung "Nichts wird mehr so sein, wie es war", Luchterhand-Verlag, 1990), wendet sich Oskar Negt gegen die modischen Tabula-rasa-Vorlieben innerhalb der westdeutschen Linken. "Diese Verabschiedungslogik, die Trümmer auf Trümmer häuft und die Vergangenheit zu einer unbewohnbaren Ruinenlandschaft werden läßt, ist jedoch eher Ausdruck eines bedrohlichen kollektiven Gedächtnisverlustes der Menschen als ihrer reflektierten Reife." Auch hierfür ließen sich aus dem Lauf der Ereignisse in den letzten Monaten Beispiele en gros anführen. Mehlhorn wie Negt und mit ihnen ja auch andere (siehe etwa Günther Grass oder Christa Wolf) beharren darauf, daß aus dem deutschen Vereinigungsprozeß die Erinnerung an die Blutspur deutscher Geschichte in diesem Jahrhundert nicht herausgedrängt werden darf. Nur das Insistieren auf diese historische Erinnerung - Negt spricht von der "Pflege und Erweiterung des kollektiven Gedächtnisses der Menschen" - bietet die Gewähr dafür, daß nicht ein weiteres Mal in der Geschichte der Deutschen, die Opfer von gestern vergessen werden, um auf der Baustelle Deutschland wieder scham- und erinnerungslos die Fahnen flattern zu lassen. Es kommt in dem hochtourig betriebenen Prozeß deutscher Einigung gerade für die demokratische Linke (schon wieder eine Tautologie als Sicherungsnetz...) darauf an, die Balance zwischen der unaufgebbaren historischen Erinnerung und den notwendigen Abschieden zu halten. Das ist, wer wollte dies bezweifeln, ein ungemein schwieriges, stets gefährdetes, aber auch interessantes, Phantasie wie Wirklichkeitssinn gleichermaßen erforderndes Unterfangen. Wer daran festhält, ist, wie es Alberto Asor Rosa, Chefredakteur der linken italienischen Wochenzeitschrift "Rinascita" in einem anderen Zusammenhang formuliert hat, "heute nicht mehr zu beneiden".
V
Für mich ist der Verlust von Gewißheiten, von linken Glaubenssätzen, das Ende aller Formen des irrealen Sozialismus, summa summarum eine große Befreiung. Daß heute und wahrscheinlich für längere Zeit linke Symbolik und Begrifflichkeit zumindest in Ost-/Mitteleuropa so sehr diskreditiert sind, empfinde ich nicht als einen Anlaß zum Trauern. Wieso sollte man darüber Tränen vergießen, daß die ganze kommunistische Nomenklatura weggefegt worden ist und mit ihnen auch die Symbolik (Hammer, Sichel, roter Stern usw.), die die große Mehrheit der Menschen in diesen Gesellschaften nun mal vornehmlich nicht als Befreiung erlebt haben. Eine Provokation sind die Ereignisse aber auf jeden Fall. Eine Provokation, sorgfältiger, reflektierter und vorsichtiger theoretisch wie praktisch an Alternativen zum Kapitalismus zu arbeiten, an Utopien eines anderen, freieren, gerechteren Lebens festzuhalten, die in dem bestehenden, nunmehr konkurrenzlosen Kapitalismus nicht eingelöst werden können. Ja dort zu allerletzt.
VI
Wenn ich dann aber sehe, was an Stelle des maroden Alten an Neuem heranreift, erfaßt mich sofort wieder das Grauen: Fremdenfeindlichkeit, übler Nationalismus, religiöser Fundamentalismus, Intellektuellenhaß, unvorstellbares soziales Elend. Jedoch, hat nicht dies alles immer schon geschlummert unter der mit linken Pathos verzierten Lüge, die von der herrschenden kommunistischen Klasse über die Gesellschaften des "realen Sozialismus" in all den vergangenen Jahren geworfen worden war? Und wenn ich auf Besserungen gegenüber dem abgestorbenen Alten hoffe, weiß ich natürlich mit Ernst Bloch auch, daß Enttäuschung zur Hoffnung gehört, "daß sie enttäuscht werden muß, weil Hoffnung keine Zuversicht ist - sondern umlagert von der Gefahr und von dem, daß es auch anders sein kann."
War aber die vor dem Hintergrund deutscher Geschichte in diesem Jahrhundert alles andere als beliebige Entscheidung, sich in linke Traditionen des Denkens und politischen Handelns einzuordnen, sich für gesellschaftliche Perspektiven jenseits des Kapitalismus einzusetzen, nicht immer schon eine Gratwanderung zwischen Hoffnung und Enttäuschung, seltenem Erfolg und häufiger Niederlage? Heute kann es doch nur darum gehen, von dem Fresko Sozialismus alles zu bewahren, was wenigstens seine ursprünglich gedachten Konturen als eine erstrebenswerte Alternative zur Barbarei, wie Rosa Luxemburg es ehedem so emphatisch formuliert hat, noch erkennen läßt. Große Worte in finsteren Zeiten, aber kleinlaut sind wir ja längst schon oft genug.
VII
Zuallerletzt noch ein Literaturhinweis. Es gibt inzwischen riesige Bergmassive von Literatur über das, was sich seit gut einem Jahr alles in Ost-/Mitteleuropa/BRD/DDR an historischen Verwerfungen ereignet hat. Mich haben die Aufzeichnungen des britischen Historikers und Journalisten Timothy Garton Ash aus den Zentren Mitteleuropas am stärksten beeindruckt, jetzt erschienen unter dem (schiefen) deutschen Titel Ein Jahrhundert wird abgewählt (München, 1990).
Carl-Wilhelm Macke
